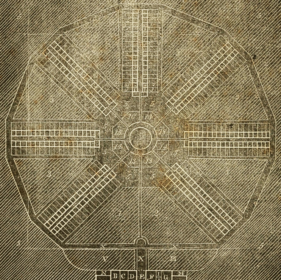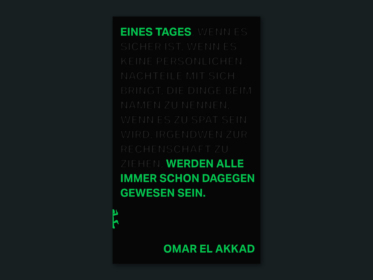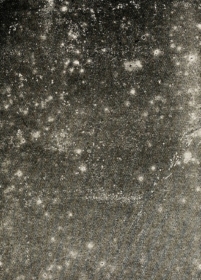Der unentwirrbare Knoten
Übersetzt von Schayan Riaz

Fast zwei Jahre nach Beginn der israelischen Zerstörung in Gaza steht die amerikanisch-jüdische Community vor einer schwierigen Entscheidung: Während Trump die Angst vor Antisemitismus unverhohlen instrumentalisiert, um seine eigene Agenda voranzutreiben, und Israel im Namen der Sicherheit der Juden die Gewalt in Gaza eskaliert, kam es in jüngster Zeit zu mehreren Fällen politischer Gewalt gegen jüdische Einrichtungen. Diese Angriffe sind Proteste gegen die israelische Politik, doch viele Stimmen behaupten, es handele sich um Antisemitismus. Solche Gewaltakte können nicht einfach rechtfertigt werden, doch wenn jüdisches Leben wirksam geschützt werden soll, dann muss eine Unterscheidung zwischen Antizionismus und Antisemitismus vorgenommen werden.
Diese vom Magazin Jewish Currents veröffentlichte Analyse bringt eine Stimmung zum Ausdruck, die viele linke amerikanische Juden teilen, und bietet einen Ausblick auf die Entwicklung einer öffentlichen Meinung, die auch in Deutschland zutreffen könnte, wo Antisemitismus und Antizionismus oft als Synonyme verwendet werden, vor allem von einer Regierung, die Israel bedingungslos unterstützt. Dieser Text bietet einen kritischen Fahrplan, um Antisemitismus von Antizionismus zu entwirren und zu erklären, was dies für eine progressive Politik bedeuten würde.
— Die Redaktion
Dieser Text erschien im englischen Original am 11. Juni 2025 bei Jewish Currents.
Am 1. Juni, einen Tag nach dem Molotowcocktail-Angriff auf eine Demonstration für israelische Geiseln in Gaza in Boulder, Colorado, habe ich eine E-Mail von meiner Synagoge erhalten. Unter Bezugnahme auf diesen Angriff, bei dem 15 Menschen verletzt wurden, sowie auf die Ermordung vor einer Veranstaltung des American Jewish Committee (AJC) von zwei Mitarbeiter:innen der israelischen Botschaft in Washington, D.C., eine Woche zuvor, bekräftigte die Gemeindeleitung in ihrer Mitteilung: „Angriffe auf jüdische Menschen als Reaktion auf einen Krieg in Israel und Gaza sind zweifellos antisemitisch.“ Der Brief erinnerte die Leser daran, dass „der Zweck antisemitischer Terrorakte darin besteht, uns Angst davor zu machen, unser jüdisches Leben öffentlich zu leben“.
Diese Interpretation der Gewalt ist sowohl unter jüdischen Gemeindevorsteher als auch unter amerikanischen Politiker:innen beider Lager weit verbreitet. „Machen Sie sich nichts vor“, erklärte der Geschäftsführer der liberalen Interessenvertretung Jewish Council for Public Affairs, „wenn Juden wegen der Handlungen Israels angegriffen werden, sollte dies klar und unmissverständlich als Antisemitismus verstanden und verurteilt werden.“ Die progressive US-Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez stimmte zu und schrieb auf X: „Antisemitismus ist hierzulande auf dem Vormarsch, und wir haben die moralische Verantwortung, ihn überall, wo er auftritt, zu bekämpfen und zu stoppen.“ Der Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson setzte noch einen drauf: „Es geht nicht um Palästina, es geht nicht um Gaza, es geht nicht um einen bestimmten Konflikt. Es geht darum, dass diese Menschen die vollständige und totale Auslöschung des jüdischen Volkes wollen.“
Die Reaktion ist sowohl vorhersehbar als auch verwirrend. So beunruhigend diese Angriffe auch sind, weder der Schütze in Washington noch der Angreifer in Colorado haben bei ihren Angriffen offensichtlich antisemitische Parolen gerufen; beide riefen „Free Palestine“. Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass sie klassische antisemitische Ansichten vertraten, wie dass sie beispielsweise eine jüdische Verschwörung für die Regierungspolitik verantwortlich machten oder Juden als besonders gierig oder verlogen hielten. Das Manifest des Schützen aus Washington enthält weder das Wort „Jude“ noch „jüdisch“ oder gar „zionistisch“. Über den Angreifer in Boulder ist weniger bekannt. Der Polizei sagte er offenbar, er wolle „alle Zionisten tot sehen“. Dennoch behaupten diejenigen, die die Gewalt als antisemitisch bezeichnet haben, im Allgemeinen, dass die Opfer nicht angegriffen wurden, weil sie Zionisten gewesen wären, sondern weil sie Juden sind. In einem repräsentativen Leitartikel der New York Times erklärte Sheila Katz, Geschäftsführerin des National Council of Jewish Women, dass die Opfer ins Visier genommen wurden, weil sie an „jüdischen Veranstaltungen“ teilnahmen. Katz’ Aussage ignoriert jedoch die Tatsache, dass das AJC als überzeugter Unterstützer des Staates Israel bekannt ist, dass die bei dem Anschlag in Washington getöteten Personen in der israelischen Botschaft arbeiteten und dass amerikanische Demonstrationen für die Freilassung von Geiseln von den meisten Beobachtern als politische Demonstrationen zur Unterstützung Israels gesehen werden. Es scheint, dass die Opfer nicht wegen ihrer jüdischen Identität angegriffen wurden, sondern wegen ihrer Unterstützung für Israel.
Wenn jedoch die Unterstützung Israels einfach Teil dessen ist, was es bedeutet, Jude zu sein, und Antizionismus gleichbedeutend mit Antisemitismus ist, warum sollte dann irgendjemand – ob studentischer Aktivist, Lobbyist im Kongress oder mörderischer Einzelgänger – eine Unterscheidung zwischen Zionismus und Judentum treffen, die die Führer der jüdischen Gemeinschaft selbst nicht treffen wollen?
Ich kann verstehen, warum manche diese Unterscheidung für irrelevant halten. Juden werden wegen ihrer Ansichten getötet und angegriffen, was zweifellos erschütternd ist. „Die Frage, ob es sich um Antisemitismus handelt oder nicht, trivialisiert das Thema“, sagte Yehuda Kurtzer, Präsident des Shalom Hartman Institute, kürzlich in einem Podcast. „Wir Juden, die Israel unterstützen, sind jetzt Ziel von Gewalttaten. Ist es wichtig, ob jemand dies als Antisemitismus bezeichnet oder nicht?“ In gewisser Weise hat Kurtzer Recht. Die Schwere der Gewalt sollte an sich schon Grund genug für eine Verurteilung sein. Für amerikanische jüdische Gemeindeleiter und Politiker ist es jedoch ohne jeden Zweifel sehr wichtig, ob diese Gewalt als „Antisemitismus“ bezeichnet wird oder nicht. Dafür gibt es offensichtliche politische Gründe. Für viele in der jüdischen Welt ist Antisemitismus ein „ewiger“ Hass, der durch alle Zeiten hindurch fortbesteht, ein Virus, der immer kurz vor dem Ausbruch steht. Wenn das die Ursache der Gewalt ist, wenn es tatsächlich keine andere Ursache als irrationale Vorurteile gibt, dann können wir wenig tun, um diese zu stoppen. Wenn man jedoch die Sicherheit der Juden im Blick hat, dann ist es unerlässlich, die Motive der Gewalt zu untersuchen, wie sie von den Tätern selbst angegeben werden. Dadurch wird die unangenehme, aber immer offensichtlicher werdende Tatsache deutlich, dass Israels Vernichtungskampagne in Gaza mit wahllosen Bombardierungen und einer Aushungerungsstrategie, wenn sie mit Juden als Ganzes in Verbindung gebracht wird, Juden auf der ganzen Welt in Gefahr bringt. Diejenigen, die sich gegen solche Anschuldigungen einsetzen, sollten sich eher dafür einsetzen, dass die Zerstörung ein Ende nimmt und diese Verbindung widerlegt wird.
Stattdessen tun jüdische Gemeindeleiter das Gegenteil. Katz schreibt leidenschaftlich: „Unsere Haltung zu diesem Krieg oder zu Israel hat keinen Einfluss darauf, wie Extremisten uns wahrnehmen. Für sie sind wir alle Juden, und allein das macht uns zur Zielscheibe von Hass und Gewalt.“ Mit anderen Worten: Der Grund für die Gewalt ist, dass die Opfer Juden sind, es hat nichts mit ihrer Unterstützung für Israel oder ihrer Identifikation mit dem Zionismus tun. Gleichzeitig macht Katz deutlich, dass es für sie keinen relevanten Unterschied zwischen beidem gibt. „Wir [Juden] wurden unvernünftigerweise aufgefordert, unsere Beziehung zu Israel vollständig zu verleugnen …, nur um von vermeintlichen Verbündeten akzeptiert zu werden.“ Sie beklagt, dass das Wort „Zionist“ zu einer „Beleidigung“ geworden ist, obwohl es nichts anderes bedeutet als „der grundlegende Glaube an die Selbstbestimmung der Juden“. Nach dieser Logik ist jeder, der sich gegen den Zionismus stellt, ein Gegner der jüdischen Freiheit, also antisemitisch. Wenn jedoch die Unterstützung Israels einfach Teil dessen ist, was es bedeutet, Jude zu sein, und Antizionismus gleichbedeutend mit Antisemitismus ist, warum sollte dann irgendjemand – ob studentischer Aktivist, Lobbyist im Kongress oder mörderischer Einzelgänger – eine Unterscheidung zwischen Zionismus und Judentum treffen, die die Führer der jüdischen Gemeinschaft selbst nicht treffen wollen?
Dieser Knoten, in dem Zionismus und Judentum so vollständig verschmelzen, dass die Ablehnung des Zionismus nicht mehr von der Ablehnung des Judentums zu unterscheiden ist, wurde bei der Geburt des Zionismus als politisches Programm im späten 19. Jahrhundert geknüpft. Die frühen politischen Zionisten waren nicht nur daran interessiert, eine Zuflucht für Juden zu schaffen, sondern auch daran, das Judentum neu zu definieren. Leon Pinsker, dessen Schrift „Autoemanzipation“ aus dem Jahr 1882 oft als erster Text des politischen Zionismus gilt, argumentierte, dass die rechtliche Gleichstellung in Europa von Natur aus nicht in der Lage sei, die Diskriminierung der Juden zu beenden, da sie andere nicht dazu bringen könne, Juden als gleichwertig anzusehen. In ihrem langjährigen Exil seien die Juden Europas „die unheimliche Gestalt eines Toten, der unter den Lebenden wandelt“. „Das rechte, einzige Mittel”, so seine Schlussfolgerung, sei „die Schaffung einer jüdischen Nationalität”, die „durch die Erwerbung einer eigenen Heimat” erreicht werden könne. Der entscheidende Punkt für Pinsker, der auch von anderen frühen Zionisten wie Theodor Herzl, Max Nordau und Micha Berdyczewski vertreten wurde, war, dass die Schaffung einer jüdischen Heimat ein Mittel zum Zweck sei, eine neue jüdische Identität zu etablieren. Juden waren keine Glaubensgenossen, sondern Mitglieder einer Nation, und nur wenn sie sich selbst als solche anerkannten, würden sie jenen stolzen Platz zurückgewinnen, den sie durch Generationen des Lebens in fremden Nationen verloren hatten. Wie Berdyczewski um die Jahrhundertwende schrieb: „Wir müssen aufhören, Juden aufgrund eines abstrakten Judentums zu sein, und Juden aus eigenem Recht werden, als lebendige und sich entwickelnde Nationalität.“ Nach diesem Schema entschieden sich Juden, die ihre nationale Identität ablehnten, für Selbstverleugnung statt Selbstachtung.
Angesichts der Tatsache, dass die Gründung Israels mit der Enteignung von 750.000 Menschen einherging, gefolgt von Jahrzehnten militärischer Herrschaft über Menschen, denen grundlegende Rechte verweigert wurden, und nun einer Kriegsführung, die von führenden Menschenrechtsorganisationen als Völkermord bezeichnet wurde, gibt es klare Gründe für die Feindseligkeit gegenüber dem Zionismus.
Es ist nicht schwer zu erkennen, wie diese Position letztendlich dazu führen würde, dass so viele darauf bestehen, der Zionismus sei keine politische Ideologie, sondern ein wesentlicher Bestandteil der jüdischen Identität – und einige sogar erklären, Juden, die den Zionismus ablehnen, seien in Wirklichkeit keine echten Juden. Wenn so viele Synagogen in Amerika israelische Flaggen in ihren Heiligtümern hissen, wenn Hillel-Zentren an Universitäten unverhohlene Zentren der Pro-Israel-Propaganda sind, wenn jüdische Gemeinschaftsinstitutionen erklären, dass diejenigen, die fordern, sich von Israel abzuwenden, offen antisemitisch sind, dann sollte es niemanden überraschen, wenn Gegner des Zionismus zu dem Schluss kommen, dass ihre politischen Gegner in Wirklichkeit die Juden als solche sind.
Viele palästinensische Aktivisten und Intellektuelle haben längst erkannt, dass eine solche Vermischung ihrer Sache schaden würde, und sich bemüht, klarzustellen, dass ihr Feind nicht das jüdische Volk ist, sondern der Staat, der palästinensisches Land gestohlen hat. Fayez Sayegh, Gründer des Palestine Research Center in Beirut, gehörte zu den beharrlichsten und differenziertesten Vertretern dieser Ansicht. Er argumentierte, dass nicht die Opposition gegen den Zionismus, sondern der Zionismus selbst direkt auf Antisemitismus aufbaute. Er stellte fest, dass sowohl Zionisten als auch Antisemiten sich in der Grundprämisse einig seien, dass Juden eine einzige Nation seien, die nicht mit anderen koexistieren könne. „Der Unterschied zwischen ihnen“, argumentierte er 1965 in seinem Werk Zionist Colonialism in Palestine, bestehe darin, dass Antisemitismus „diese angeblichen nationalen Eigenschaften verachte“, während „der Zionismus sie idealisiert“. In einem Refrain, der jedem pro-palästinensischen Aktivisten vertraut ist, betonte er: „Ich bin antiisraelisch. Ich bin auch antizionistisch. Aber ich bin nicht antisemitisch.“ Bestimmte jüdische Kommentatoren konnten einsehen, wie schwierig es war, diese Unterscheidung aufrechtzuerhalten. 1968 stellte der israelische Schriftsteller und Historiker Nissim Rejwan in einem Brief an einen Kollegen fest, dass die Unterstützer Israels beides wollten: Sie forderten von den Arabern, zwischen Juden und Zionisten zu unterscheiden, und bestanden gleichzeitig darauf, dass „man keine Grenze zwischen Zionismus und Judentum ziehen kann, da Ersterer die nationale Befreiungsbewegung der Juden ist“. Wer seien wir, fragte er später den amerikanischen Kritiker Irving Howe, „dass wir die Araber des Antisemitismus bezichtigen, wenn sie doch nur in die ideologische Falle getappt sind, die die Zionisten für sie aufgestellt haben?“
Es stellte sich heraus, dass dies nicht nur eine Falle für Palästinenser:innen war, die gegen die Enteignung durch die Zionisten kämpften. Es ist auch zu einer Falle für Juden geworden. Angesichts der Tatsache, dass die Gründung Israels mit der Enteignung von 750.000 Menschen einherging, gefolgt von Jahrzehnten militärischer Herrschaft über Menschen, denen grundlegende Rechte verweigert wurden, und nun einer Kriegsführung, die von führenden Menschenrechtsorganisationen als Völkermord bezeichnet wurde, gibt es klare Gründe für die Feindseligkeit gegenüber dem Zionismus. Und wenn die Unterstützung Israels wesentlich zum Judentum gehören soll, dann muss Feindseligkeit gegenüber Israel zwangsläufig auch Feindseligkeit gegenüber Juden bedeuten. Diese Dynamik nährt sich selbst wie ein Teufelskreis: Diese Feindseligkeit beweist den Juden, dass Antisemitismus eine bösartige und ewige Kraft ist, was die Vorstellung verstärkt, dass ein militarisierter Ethnostaat für die Sicherheit der Juden unerlässlich ist, was die Unterstützung für die Sicherheit dieses Staates erhöht, was Israels anhaltende Enteignungskampagnen rechtfertigt, was wiederum die ursprüngliche Feindseligkeit verstärkt. Das Ganze wiederholt sich. Deshalb haben diejenigen, die vor einer zunehmenden Bedrohung für Juden warnen, Recht, auch wenn sie die Gründe dafür falsch zuordnen. Studien haben seit langem gezeigt, dass mit zunehmender Gewalt Israels auch die Gewalt gegen Juden zunimmt.
Es braucht jedoch keinen hartgesottenen Materialisten, um darauf hinzuweisen, dass diejenigen, die die Bomben herstellen, die ganze Familien in Gaza töten, mehr Verantwortung für diese Morde tragen als diejenigen, die in Boulder demonstrieren.
Für viele Juden ist es zu riskant oder unangenehm, über die beunruhigenden Folgen zu diskutieren, die sich aus der Vermischung von Judentum und Zionismus ergeben – ähnlich wie bei der Schuldzuweisung an Opfer. Aber die Beschreibung, wie die Bedingungen für Gewalt entstehen, entlastet nicht die Person, die direkt für diese Gewalt verantwortlich ist; unabhängig von der Motivation können und müssen wir klarstellen, dass Zivilisten nicht wegen ihrer politischen Positionen getötet oder verstümmelt werden dürfen. Genauer gesagt spiegelt die Vorstellung, dass diese Demonstranten in Boulder ein geeignetes Ziel für Gewalt von Menschen sein könnten, die über die israelische Politik verärgert sind, eine verzerrte Perspektive wider, in der die Unterscheidung zwischen Identität, Mitschuld, Verantwortung und Macht aufgelöst ist. Auch wenn die Grenzen zwischen diesen Kategorien nicht immer klar sind, bleibt es wichtig, sie dennoch zu ziehen. Dass diese Grenzen verwischt werden, ist leider kein Einzelfall, sondern geradezu alltäglich in einer politischen Kultur, in der Machtfragen oft auf Identitätsfragen reduziert werden. Wir auf der linken Seite sind dagegen nicht immun, wo verschiedene Grade von Mitschuld häufig zu einer pauschalen „zionistischen“ Identifizierung verflacht werden. Es braucht jedoch keinen hartgesottenen Materialisten, um darauf hinzuweisen, dass diejenigen, die die Bomben herstellen, die ganze Familien in Gaza töten, mehr Verantwortung für diese Morde tragen als diejenigen, die in Boulder demonstrieren. Ob der CEO von Lockheed Martin Jude ist oder nicht, ist natürlich irrelevant. Es ist auch irrelevant, ob er Zionist ist. Damit soll keine Liste bevorzugter Ziele für Gewalttaten vorgelegt werden. Es soll vielmehr betont werden, dass eine Politik, die sich mehr mit Identitätsetiketten als mit Machtstrukturen beschäftigt, nicht wirksam sein kann und sich auf gefährliche Weise ausbreiten kann.
Doch diejenigen, die bestimmte Personen und Institutionen für ihre Unterstützung der anhaltenden Zerstörung in Gaza zur Rechenschaft ziehen wollen, werden keine Hilfe von der jüdischen Welt erhalten. Deren Vertreter betonen immer wieder, dass es keinen Unterschied gibt zwischen einem Synagogengottesdienst, einem Marsch für Geiseln oder einer AJC-Veranstaltung für Diplomaten – oder dass eine kommunale Resolution für einen Waffenstillstand, ein Protestcamp an einer Hochschule und ein Brandanschlag auf einen friedlichen Marsch allesamt gleichermaßen Zeichen antijüdischen Hasses sind. Die schreckliche Ironie dabei ist, dass solche Erklärungen zwar im Namen der Sicherheit der Juden abgegeben werden, aber nichts dazu beitragen, ihre Sicherheit tatsächlich zu erhöhen. Indem sie die Ansicht bekräftigen, dass Juden unabhängig davon, wo sie leben und was sie tun oder sagen, in Gefahr sind, lenken solche Appelle davon ab, die Ursachen für solche Gewalt anzugehen. Anstatt allgemeine Unterstützung für den „Kampf gegen Antisemitismus“ zu fordern, müssen diejenigen, die Juden tatsächlich schützen wollen, ihren Blick von der Gewalt der jüngsten Angriffe weg und hin zu den Bombenangriffen und der Aushungerung von Millionen Menschen in Gaza richten. Dazu muss man die jüngsten Angriffe nicht als Beweis für einen ewigen Hass anerkennen, sondern als destruktive Reaktionen auf einen unmoralischen Krieg.