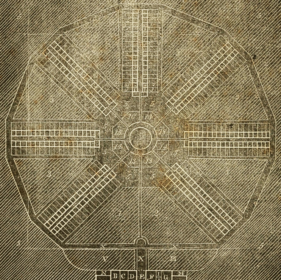Strukturen Müssen Getrennt Werden
Das Konzept des karzeralen Anti-Antisemitismus scheint zu großen Teilen auf einer Instrumentalisierung des Antisemitismus Begriffs zu beruhen. Auch wir wollen uns für einen nicht-karzeralen Anti-Antisemitismus einsetzen und plädieren in diesem Rahmen für eine Trennung von karzeralem Anti-Antisemitismus und den karzeralen Maßnahmen, die hinter der Instrumentalisierung von Antisemitismus-Vorwürfen stecken.
Die nachfolgende Kritik ist vor dem Hintergrund eines kollektiven Austausch-Treffens zum Text „Für einen nicht-karzeralen Anti-Antisemitismus“ entstanden.
Unsere Gruppe bestand aus neun Personen, die in unterschiedlichen, größtenteils abolitionistischen Grassroots-Gruppen in Köln aktiv sind, darunter jüdische, palästinensische und andere migrantische Perspektiven. Der Artikel basiert auf dem Wissen, das aus der Diskussion entstanden ist – bildet jedoch keine Gruppenposition ab.
Das staatliche Framing von Anti-Antisemitismus muss herausgefordert werden
Die Notwendigkeit, Antisemitismus sowohl gesamtgesellschaftlich als auch innerhalb der Bewegungen für soziale Gerechtigkeit zu bekämpfen, sehen wir auch in unserer Organisierung in Köln.
Der verwendete Begriff des karzeralen Anti-Antisemitismus kann aus unserer Perspektive jedoch dazu beitragen, die Grenze zwischen dem Vorwurf des Antisemitismus und tatsächlichem Antisemitismus zu verwischen. Auch soweit Problematiken wie Kritik an der IHRA-Definition und die Trennung zwischen vermeintlichem und tatsächlichem Antisemitismus angesprochen werden, gelingt es dem Text aus unserer Sicht nicht, sich davon zu lösen.
Nach den Autor:innen liegt „das größte Problem [..] in der Art der Maßnahmen, die angewendet werden sollen, um Vorfälle von tatsächlichem oder vermeintlichem Antisemitismus zu bekämpfen.“
Unter „vermeintlichen Antisemitismus“ verstehen wir die Diskurse, die systematische Kritik am Staat Israel per se als antisemitisch definieren, selbst wenn diese sich auf zahlreiche Berichte internationaler Menschenrechtsorganisationen bezieht. Das halten wir für ebenso zentral und untrennbar mit der Einführung der Maßnahmen verbunden. Bereits diese pauschale Kategorisierung systematischer Kritik als Antisemitismus und damit deren „Bekämpfung“ (karzeral oder anderweitig) stellt durch das Labelling ein Problem dar, mit dem zugleich karzeral mobilisiert wird und gleichzeitig Palästinenser:innen das Recht genommen wird sich gegen ihre Vertreibung und Unterdrückung auszusprechen.
Darin sehen wir auch einen wichtigen Unterschied zur vorgeschlagenen Analogie des karzeralen Feminismus:
So wie wir karzeralen Feminismus verstehen, stellt die karzerale Praxis eine falsche Reaktion auf patriarchale Gewalt dar und reproduziert sie zugleich. Beim karzeralen Anti-Antisemitismus hingegen scheint es entscheidend zu sein, darauf hinzuweisen, dass es sich teils um Reaktionen auf reale antisemitische Gewalt handelt und teils um eine Umdeutung von Umständen, die fälschlicherweise als antisemitische Gewalt klassifiziert werden.
Der Artikel beschreibt Fälle, in denen der karzerale Staat gegen den Vorwurf des Antisemitismus mobilisiert wird, als „Kollateralschäden“ des karzeralen Anti-Antisemitismus. Dies wird dem intentionellen Charakter dieser Praktiken aus unserer Sicht nicht ganz gerecht.
Wir sehen die beschriebene karzerale Wende gerade in der Entleerung und Verschiebung des Antisemitismusbegriffes mitbegründet und beziehen uns dabei auf die Anwendung des Philosemitismus Begriffes von Ma’ayan Ashah und Danna Marshall. Die von den Autor:innen nachgezeichnete Instrumentalisierung des Antisemitismusvorwurfs als Grenzmechanismus, ermöglicht seit dem 07. Oktober 2023 gerade aufgrund dieser Mechanismen eine karzerale Wende. Wie auch Yossi Bartal in seinem Artikel „Die Rückkehr des Schutzjuden“, sehen sie darin eine Kontinuität des Philosemitismus, der in der aktuellen autoritären Wende ein Werkzeug zur Herstellung des hegemonialen Konsenses darstellt.
Philosemitismus bezeichnet nach Michel Wieviroka „die Idealisierung eines Judentums durch nicht-Juden, dass zu Teilen auf Projektionen beruht.“ Während Antisemitismus historisch dazu genutzt wurde, Unterdrückung durch das Feindbild des Juden zu ermöglichen, wird beim Philosemitismus der vorgebliche Schutz jüdischen Lebens genutzt, um Unterdrückung durchzusetzen. In seiner aktuellen Funktionsweise findet dieser Mechanismus — abstrahiert von tatsächlichem Anti-Antisemitismus — über ein Trugbild des Judentums statt, das diesen mit dem Staat Israel gleichsetzten will.
Antisemitismus wird hierdurch auf Palästinenser:innen und muslimisch gelesenen Menschen projiziert, gleichzeitig findet eine Auslagerung und eine „Entlastung“ der weißen, deutschen Bevölkerung statt. Widersprechen Jüdinnen:Juden diesem Narrativ, wenn sie Israel kritisieren, so gilt es diese Brüche in der Erzählung zu unterbinden und auch sie trifft der Vorwurf des Antisemitismus.
Die Verschränkung rassistischer Bilder mit diesem Narrativ des Anti-Antisemitismus ermöglicht in Kombination mit Jahrzehnten selektiver Erinnerungspolitik eine Durchsetzung autoritärer Maßnahmen, die über staatliche Akteure hinausgehend gesellschaftliche Zustimmung findet und Universitäten, Medien und Kultur miteinbezieht. In unseren Bewegungen erleben wir vormals „Linke“, die im Namen des Kampfes gegen Antisemitismus, Menschen mit prekärem Aufenthalt aufgrund von Palästinasolidarität öffentlich als Antisemit:innen darstellen und Fotos an Ermittlungs- und Ausländerbehörden weitergeben.
Wenn wir in unserer Analyse das Narrativ der karzeralen Maßnahmen des Staates übernehmen, es handele sich in diesen Fällen um Anti-Antisemitismus, verkennen wir damit einen wesentlichen Bestandteil der aktuellen philosemitischen Funktionsweise.
Perspektive
Wir erkennen den tatsächlichen Antisemitismus in der Gesellschaft sowie in unseren Bewegungen als ein ernstes Problem an, an dem wir arbeiten müssen. Um „Antisemitismus in der Bewegung“ zu adressieren, halten wir es gleichzeitig für notwendig die These des „Antisemitismus der Bewegung“ zu demontieren.
Eine zentrale Herausforderung im Kampf gegen Antisemitismus innerhalb antirassistischer Bewegungen besteht für uns derzeit darin, dass wir Antisemitismus aufgrund seiner Instrumentalisierung in zweifacher Weise erklären müssen:
Einerseits muss Antisemitismus als Problem thematisiert werden, andererseits erfordert es eine zusätzliche Erklärung, warum die angesprochene Problematik nicht bloß eine Instrumentalisierung des Antisemitismusbegriffs gegen Palästinenser:innen darstellt. Diese Unterscheidung klarer zu machen, halten wir für essenziell, um Antisemitismus wirksam zu bekämpfen.
Wir haben in der Gruppe diskutiert, dass aus unserer Sicht eine Anpassung des Konzepts karzeraler Anti-Antisemitismus nötig wäre, um nicht an den falschen Stellen Antisemitismus in widerständigen Praxen zu suggerieren
Wir halten es daher für sinnvoll, karzeralen Anti-Antisemitismus und die karzerale Instrumentalisierung des Antisemitismusbegriffs als zwei unterschiedliche Strukturen zu betrachten zwischen denen Verbindungen bestehen, die aber dennoch nicht unter einem einzigen Begriff summiert werden können.
Wir finden Calling Ins und weitere feministische, abolitionistische Praktiken im Kampf gegen Antisemitismus ebenso wichtig, wie die Autor:innen, jedoch sehen wir darin keine Lösung für instrumentalisierte und falsche Antisemitismus-Vorwürfe.