Spracherwerb
Übersetzt von Grashina Gabelmann
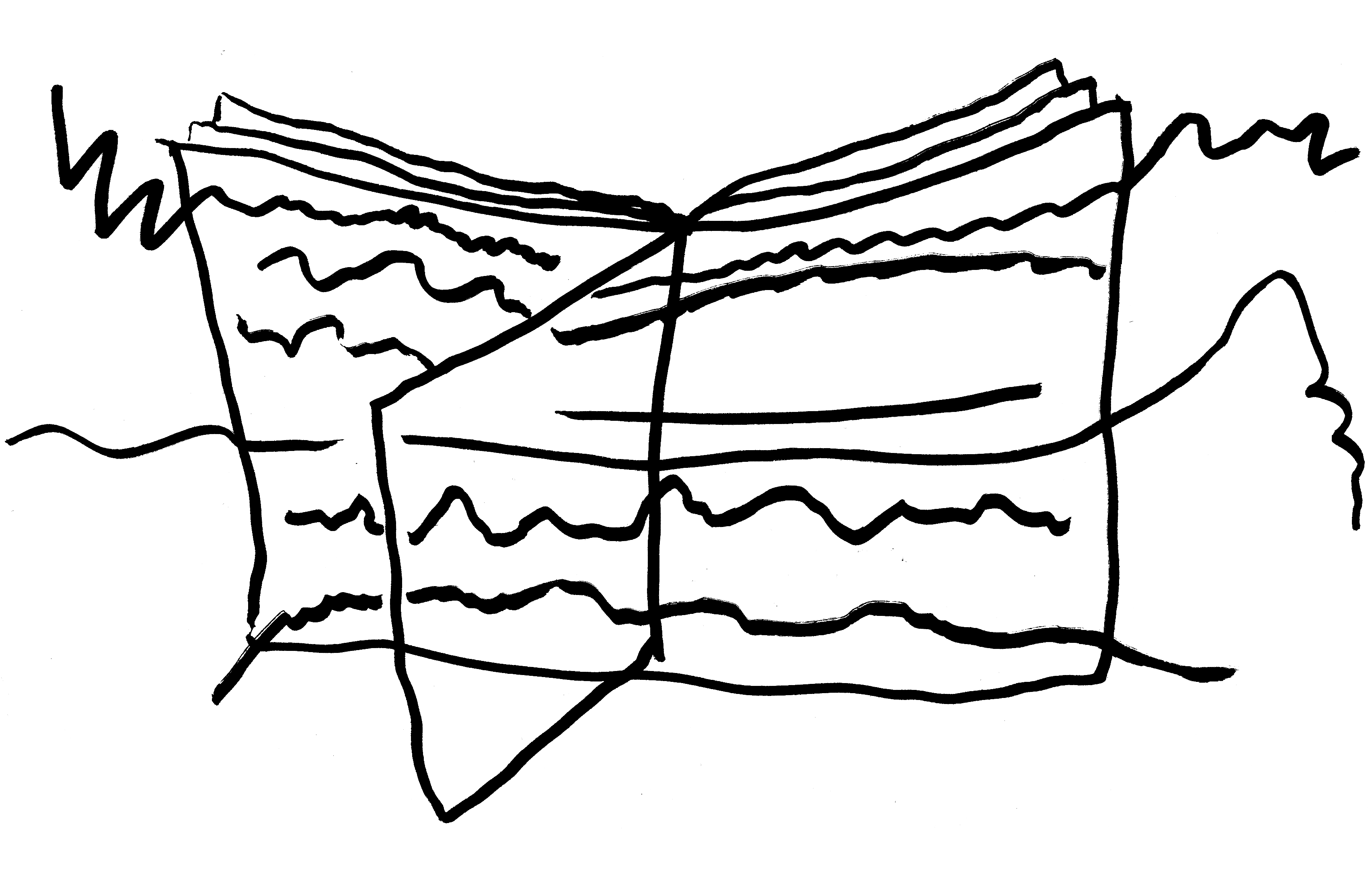
Kurz nach meinem Umzug von New York nach Berlin belegte ich, wie viele Zugezogene, einen Deutschkurs. Einmal pro Woche brachte der Kurs Schüler:innen aus Luxemburg, Italien, den Niederlanden, den USA, Estland, Südkorea, Bangladesch, der Türkei, dem Iran, Großbritannien, Venezuela, Irland und Brasilien zusammen. Unsere Lingua Franca war genau die eine Sprache, die wir uns alle gemeinsam schämten, nicht sprechen zu können.
Unsere Fähigkeit, differenzierte Gespräche zu führen, war daher allenfalls begrenzt. Mit besten Absichten hatte unsere Lehrkraft das Klassenzimmer in eine Miniaturversion der Vereinten Nationen verwandelt. Wir wurden zu widerwilligen Botschaftern unserer Herkunft gemacht, und mussten unsere Familien, unser Lieblingsessen, Feiertage, Filme, lokale Bräuche und Besonderheiten unserer Bildungssysteme präsentieren – in stockendem Deutsch, jedes zweite Wort ein Fehler.
Ich empfand diese Aufgaben als endlos frustrierend. In Kurzvorträgen sollten wir unsere komplexen Verbindungen zu unseren Heimatländern, unsere politischen Einstellungen und Identitäten in starre Kategorien pressen und auf belanglose Vergleiche reduzieren. Wenn jemand etwas Interessantes erzählte, war es unmöglich, Nachfragen zu stellen oder echte Schnittpunkte zu benennen.
Es klingt wie eine Binse, aber anscheinend muss es dieser Tage gesagt werden: Interessante Gespräche und öffentlicher Diskurs Diskurs setzen voraus, dass wir uns grundlegend verstehen – was ohne etwas Anstrengung, Unannehmlichkeit und Sprachkompetenz kaum zu erreichen ist.
Ich muss in letzter Zeit oft an diesen Deutschkurs zurückdenken, vor allem, wenn ich meinen Freunden in den USA erklären soll, was hier in Deutschland gerade vor sich geht. Mich befällt nämlich das gleiche Gefühl von Unfähigkeit, wenn ich beschreiben soll, wie weit entfernt Deutschland vom Rest der Welt liegt, welche historischen Sonderfälle und kulturellen Machtverhältnisse die Situation hier so ausgesprochen trostlos erscheinen lassen.
Oder wie soll man einem amerikanischen Juden in New York, dessen Großeltern den Holocaust überlebt haben, eine aktuelle Unterüberschrift in einer der größten deutschen Zeitungen erklären: ‘Antisemitische Gewalt richtet sich vor allem gegen die Polizei?’ Das ergibt vielleicht syntaktisch Sinn, aber der Kontext fehlt, und der Kontext selbst macht oft alles nur absurder.
Wir leben, grob gesagt, in einer Zeit des autoritären Wandels. Rechtsextreme ultra-nationalistische Parteien gewinnen weiterhin an Macht; wo sie schon an der Macht sind, radikalisieren sie sich noch weiter. Zu den ersten Folgen gehören der Tod der Differenzierung, der Rückzug in bequemere Diskursräume und das Verschwinden sinnstiftender Debatten. Wir müssen wieder einmal lernen, dass es schwierig ist, ein Gespräch mit jemandem zu führen, der ein grundlegend anderes Verständnis von Wahrheit hat.
Berlin hat mich schon immer angezogen, weil es eine kosmopolitische Stadt ist. Fast ein Viertel seiner Einwohner:innen sind im Ausland in über 170 verschiedenen Ländern geboren, Berlin ist der Ort, an dem Westeuropa auf den Osten trifft, wo der globale Norden mit dem globalen Süden in Kontakt kommt. Die besonderen demographischen Gegebenheiten der Stadt ermöglichen Begegnungen von Lebenswelten, die in anderen Teilen der Welt undenkbar wären: Europas größte palästinensische Diaspora lebt Seite an Seite mit einer wachsenden Zahl israelischer Expats.
Diasporisch sein heißt: sich gleichzeitig an zwei Orten zu befinden, an dem, wo man ist, und an dem, woher man kommt. Als amerikanische Jüdin kann ich dieser Definition viel abgewinnen, obwohl sie, historisch gesehen, oft als antisemitische Trope diente und inzwischen zunehmend gegen andere migrantische Communities gewendet wird. Diasporisch zu sein bedeutet, immer im Dazwischen zu stehen, niemals vollständig dorthin zu gehören, wo man ist, oder dorthin, woher man kommt. Deshalb kann der Zustand der Diaspora als ein Akt der Übersetzung zwischen verschiedenen Orten verstanden werden, der mithilfe von Vokabeln aus beiden Sprachen das Gespräch zwischen ihnen ermöglicht.
Für mich ist das der Kern von the Diasporist: Gedanken durch Kontexte hinweg zu übersetzen, aus kritischer Distanz Geschichten zu erzählen, Ideen aus mehreren Perspektiven zu betrachten und internationalistische Bezugssystem aufzubauen. Unsere Beiträge erzählen von Erfahrungen des Dazwischen, und neugierige und der Welt zugewandte Geschichten, mit Platz für Zwischentöne und einer Einladung dazu, verschiedener Meinung zu sein. Unser Inhalt wird zweisprachig veröffentlicht, damit englischsprachige Lesende erfahren können, welche Gespräche in Deutschland stattfinden, und um Deutschland zu zeigen, was in der restlichen Welt (und manchmal auch in Deutschland selbst) geschieht. Für uns ist das ein Experiment: Was passiert, wenn wir versuchen, on the same page zu beginnen?
Wir beginnen mit Millay Hyatt, die über ihre Kindheit als Tochter evangelikaler Missionare aus den USA auf geheimer Mission in der DDR schreibt. Ghayath Almadhoun teilt zwei Gedichte, die den Schmerz und die Absurdität von Exil, Trauer, Krieg und Sehnsucht erkunden. Ben Mauk spricht mit Sarah Schulman über mögliche Lehren des AIDS-Aktivismus für heutige Solidaritätsbewegungen. Emily Dische-Becker denkt über die Verbindung zwischen Sparpolitik und Zensur sowie Strategien des Überlebens im Autoritarismus nach. Und Maria Wollburg betrachtet die komplexen Geschichten von Lust und Gewalt, die in der Auster stecken.
In den kommenden Monaten werden wir neue Texte veröffentlichen, die auf dem aufbauen, was wir bereits veröffentlicht haben, es ergänzen, davon abweichen und manchmal auch völlig im Widerspruch dazu stehen. Unsere Autor:innen werden Ecken des Lebens und Debatten in Deutschland betrachten, die noch nicht viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Und wir wollen Geschichten aus dem Ausland lesen, die hier ein eigenes Echo finden werden.
Es ist wichtig, dass Deutschland im Gespräch mit dem Rest der Welt bleibt, nicht nur, weil die Entscheidungen Europas größter Wirtschaftsmacht weit über ihre Landesgrenzen hinaus Auswirkungen haben. Sondern auch, weil wir sehen, wie Themen, Taktiken, Gesetze und Aktionen, die hier stattfinden, sich in Frankreich, den Niederlanden, Argentinien und Ungarn wiederholen, und umgekehrt. Wie Emily Dische-Becker in ihrem Gespräch über „inneres Exil“ sagt: Wir haben viel voneinander zu lernen.
In der Übersetzungstheorie gibt es zwei Ansätze: Domestication, – die Einbürgerung, die Anpassung eines Textes an die Zielkultur – und Foreignization, – die Verfremdung, die Bewahrung bestimmter Rhythmen, von Logik und Normen, die dazu zwingt, sich dem Text zu seinen eigenen Bedingungen zu nähern.
Das ist eine ästhetische Unterscheidung, aber, so scheint es mir, auch eine moralische. Bei the Diasporist wissen wir die stacheligen Umrisse individueller Erfahrungen zu schätzen, und auch die scharfen Kanten einzelner Meinungen, selbst wenn sie an tief verwurzelte Überzeugungen anecken. Nuancen können nur entstehen, wenn es Unstimmigkeit gibt.
In letzter Zeit habe ich auch über Sprachkurse als nützliches Paradigma nachgedacht: Am Anfang sind sie nervig, aber sie sind auch ein gemeinsames Projekt, in dem Fehler, Meinungsverschiedenheiten, Fragen und Missverständnisse erlaubt sind, um gemeinsam zu lernen, wie wir einander in unserer ganzen Vielschichtigkeit begegnen können. Was so simpel klingen mag, scheint mir eine Grundvoraussetzung für jeden Akt der Kommunikation zu sein. Dieses Land ist gerade mehr damit beschäftigt, jede Solidarität mit Menschen, die unvorstellbarer Gewalt ausgesetzt sind, anzufechten, als sich mit der Gewalt selbst auseinanderzusetzen. Wie könnte da ein Raum aussehen, den wir schaffen, um eine gemeinsame Sprache zu entwickeln und in ein echtes Gespräch einzutreten, Streitpunkte zu bestimmen, anderen zuzuhören und unsere eigenen Perspektiven einzubringen?
Optimismus fällt mir zunehmend schwer. Aber ich bin, wie jeder andere Mensch auch, von dem gleichen zerbrechlichen Drang angetrieben, mich selbst verständlich zu machen und die Welt besser zu verstehen. Wir müssen daran glauben, dass sich das Unbehagen, die Verletzlichkeit, das Stottern und der Frust, es immer wieder zu versuchen, lohnen werden.