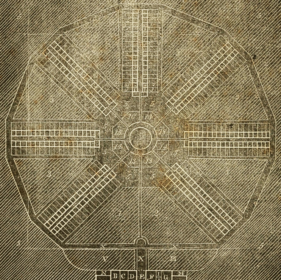Deutschland ist nicht dein Freund
Übersetzt aus dem Englischen von Miriam Rainer

Lassen Sie mich Ihnen etwas über deutsche Gastfreundschaft erzählen: 2006, als Deutschland die Fußball-Weltmeisterschaft ausrichtete, war das offizielle Motto „Die Welt zu Gast bei Freunden.“ Die offizielle englische Version des Mottos lautete: „A time to make friends.“Deutschland wollte seinen Ruf als strenges, ungastliches Land ablegen und freundlich und einladend wirken. Dieser Slogan trug zweifellos dazu bei.
Ich erinnere mich an einen bestimmten Schulmorgen im selben Jahr, kurz bevor die Weltmeisterschaft beginnen sollte. Unser Lehrer trat ins Klassenzimmer und hielt ein Faltblatt des Afrika-Rats hoch, einer Organisation, die die Interessen der afrikanischen Diaspora in Berlin vertritt. Die Broschüre warnte Besucher*innen vor gewissen „No-Go-Zonen“. Besonders Schwarze Fußballfans sollten östliche Teile der Hauptstadt wie die Bezirke Marzahn-Hellersdorf oder Köpenick möglichst meiden. Die Zeit des „Sommermärchens“ war sicher eine gute Zeit, um neue Freundschaften zu knüpfen, doch während Deutschland die Welt zu Gast hatte, waren die alten Freunde, die Nazis, nie fort gewesen.
Ich denke oft zurück an diesen Moment. Einerseits leben und arbeiten wir in einem Land, das nach außen hin warm und aufgeschlossen sein möchte. Es will, dass alle glauben, es würde alles dafür tun, sich gastfreundlich zu zeigen und denen beizustehen, die bedürftig sind. Und das tut es auch, natürlich. Aber andererseits hatte Deutschland historisch betrachtet immer schon die Neigung, die eigene Bevölkerung wie Gäste und Gäste wiederum misstrauisch zu behandeln. Wer kann das virale Video von vor einigen Jahren vergessen, in dem zwei Berliner Polizisten einen syrischen Mann gewaltsam zu Boden drücken, der mehrere Bußen fürs Schwarzfahren nicht bezahlt hat, wobei einer der Beamten zur Frau des Mannes sagt: „Das ist mein Land, Du bist hier Gast“? Das Gastsein hat, je nachdem, wer Gast ist, unterschiedliche Bedeutungen. Und in Deutschland, scheint mir, kann niemand, den diese Zuschreibung trifft, gewinnen.
„Die Welt zu Gast bei Freunden“ – diese Phrase kommt mir immer wieder in den Sinn. Zuletzt insbesondere im Februar, als die Internationalen Filmfestspiele Berlin, kurz: die Berlinale, in betäubender Kälte stattfanden, neue Filme aus aller Welt präsentiert und glamouröse Gala-Premieren auf dem roten Teppich veranstaltet wurden.
Ich habe die letzten 15 Jahre jährlich über die Berlinale berichtet, meist als Filmkritiker, aber einige Male auch als unabhängiges Jurymitglied. Was mich stets beeindruckt hat: Das Festival ist nie vor politischen Themen zurückgeschreckt. Von den „Big Five“ – neben Sundance, Cannes, Venedig und Toronto – gilt die Berlinale als das politischste Festival, ein Anspruch, den sie stolz auf ihrer Website bewirbt. Das Festival hat sich entschieden für inhaftierte Künstler:innen eingesetzt, sei es für den iranischen Regisseur Jafar Panahi, die simbabwische Schriftstellerin Tsitsi Dangarembga oder andere. 2023 verurteilte das Festival Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und ermöglichte Demonstrationen auf dem roten Teppich durch den ukrainischen Botschafter zusammen mit Mitwirkenden ukrainischer Filme, die beim Festival liefen. Im selben Jahr fand das Festival trotz seines vollen Programms Platz, um die massiven Proteste im Iran zu würdigen, die wenige Monate zuvor durch den Tod von Jina Mahsa Amini in Gewahrsam der Sittenpolizei ausgelöst worden waren.
Diese Entscheidungen sind absolut nachvollziehbar. Warum sollte ein internationales Filmfestival nicht auf Geschehnisse außerhalb seines Gastgeberlandes eingehen – insbesondere, wenn die gezeigten Filme sich mit globalen Fragen befassen? Es beweist auch, dass es durchaus möglich ist, kurzfristig Podiumsdiskussionen ins Programm aufzunehmen, wenn das Festival ein Thema nur für wichtig genug erachtet.
Als Burhan Qurbanis Film „Kein Tier. So Wild.“ auf der diesjährigen Berlinale Premiere feierte, hat Roth da auch selektiv applaudiert? Die Adaption von Shakespeares „Richard III.“ versetzt die Geschichte ins Milieu „arabischer Clans“ in Berlin und wurde von Roth mitfinanziert. Ob Roth nach der Sichtung des Films auch für die palästinensische Schauspielerin Hiam Abbas applaudiert hat, die eine der Hauptrollen spielt?
Doch zwischen den Ausgaben in 2024 und 2025 hat die Berlinale Schwierigkeiten gehabt, diese Art von Solidarität zu demonstrieren. Vier Monate nach dem 7. Oktober fand das letztjährige Festival in einem Klima weitverbreiteter Ausladungen, Absagen und Zensuren von allem statt, was auch nur entfernt pro-palästinensisch war. Nur einen Monat zuvor hatte die Heinrich-Böll-Stiftung beschlossen, ihre Preisverleihung des Hannah-Arendt-Preises an Masha Gessen abzusagen. In dieser angespannten Atmosphäre gelang es „No Other Land“ den Preis der Berlinale für den besten Dokumentarfilm zu gewinnen. „No Other Land“, ein Film, der kürzlich auch den Oscar 2025 für den besten Dokumentarfilm erhalten hat, wurde von einem palästinensisch-israelischen Kollektiv unter der Leitung von Yuval Abraham und Basel Adra gedreht und befasst sich mit der Zerstörung palästinensischer Häuser durch israelische Bulldozer im Westjordanland. Der Film gewann, während zeitgleich Bomben auf Gaza fielen. Abraham und Adra nutzten ihre Dankesreden, um sich direkt an die im Saal anwesenden Politiker:innen zu wenden und forderten Deutschland auf, die Waffenlieferungen an Israel einzustellen sowie einen sofortigen Waffenstillstand zu unterstützen.
Die Reaktionen auf die Dankesreden wurden zu einem legendären Kapitel in der Geschichte der Berlinale: Bundeskanzler Olaf Scholz, der nicht anwesend war, kritisierte die Einseitigkeit der Perspektive von Adra und Abraham, Berlins Bürgermeister Kai Wegner bezeichnete die Reden der Filmemacher als antisemitisch und Claudia Roth, die Beauftragte für Kultur und Medien, setzte dem Ganzen noch die Krone auf, indem sie erklärte, dass sie während der Zeremonie nur für den Israeli Yuval Abraham und nicht für den Palästinenser Basel Adra applaudiert habe. Ich kann nicht anders, als mich zu fragen: Als Burhan Qurbanis Film „Kein Tier. So Wild.“ auf der diesjährigen Berlinale Premiere feierte, hat Roth da auch selektiv applaudiert? Die Adaption von Shakespeares „Richard III.“ versetzt die Geschichte ins Milieu „arabischer Clans“ in Berlin und wurde von Roth mitfinanziert. Ob Roth nach der Sichtung des Films auch für die palästinensische Schauspielerin Hiam Abbas applaudiert hat, die eine der Hauptrollen spielt?
Und der Bürgermeister Kai Wegner, der sich nur wenige Tage vor Festivalbeginn öffentlich für ein Verbot der arabischen Sprache bei Palästina-solidarischen Demonstrationen stark gemacht hatte, wurde als Ehrengast zur Eröffnungszeremonie eingeladen. Gezeigt wurde an jenem Abend Tom Tykwers „Das Licht“. Der Film beginnt – was für eine Ironie – mit Dialogen auf Arabisch. Diese angeblich so gefährliche Fremdsprache durchzieht den gesamten 162-minütigen Film. Was ging wohl im Kopf des Bürgermeisters vor? Verließ er empört den Saal? Und falls nicht – falls er tatsächlich bis zum Abspann durchhielt – was nahm er mit aus einem Film, der sich, wenn auch manchmal unbeholfen und absurd, mit den großen Themen Familie, Migration und Neo-Kolonialismus auseinandersetzt? Hat er den Film gesehen und dabei gedacht: Jetzt wäre wieder „Zeit, Freundschaften zu knüpfen?“
Unter Berücksichtigung dieser Punkte war ich gespannt, wie die neue Berlinale-Direktorin Tricia Tuttle, die seit letzten April an Bord ist, mit all dieser Spannung umgehen würde. Wie genau würde sie die Ereignisse der vergangenen zwölf Monate zur Sprache bringen und mit dem schwierigen Erbe des Festivals aus dem Vorjahr verfahren?
Zunächst gab es es gemischte Signale: Als „No Other Land“ im November 2024 in deutschen Kinos anlief, äußerte sich Tuttle öffentlich und sagte, dass sie weder den Film noch die Reden von Adra und Abraham als antisemitisch empfand. Doch einen Monat später wurde bekannt, dass ein Berlinale-Mitarbeiter angezeigt worden war, weil er eine Arbeits-E-Mail mit „From the river to the sea, Palestine will be free“ unterschrieben hatte.
Die Boycott, Divestment and Sanctions, kurz: BDS-Bewegung, rief im Januar 2025 offiziell zum Boykott der Berlinale auf. Diese Ankündigung kam, nachdem bereits Tilda Swinton ausgewählt worden war, um bei der Eröffnungszeremonie einen Ehrenpreis zu erhalten, eine Schauspielerin, die einen frühen Brief von „Artists for Palestine UK“ unterzeichnet hatte, der zu einem Waffenstillstand aufrief. Swinton bat die Berlinale nicht nur, Peter Wollens „Friendship’s Death“ zu zeigen, ein früheres Werk von ihr, in dem sie eine pro-palästinensische Außerirdische spielt, sondern sie drückte am nächsten Tag auf einer Pressekonferenz auch ihre Bewunderung und ihren Respekt für die BDS-Bewegung aus – während Tuttle direkt neben ihr saß. Ein gefundenes Fressen für bestimmte Journalist:innen und Politiker:innen, die auf den nächsten Antisemitismus-Skandal lauerten, nur wenige Tage, nachdem sich die Berlinale offiziell von der rechtlich nicht bindenden „Antisemitismus-Resolution“ des Bundestags distanziert hatte (diese hatte explizit Ereignisse der Berlinale 2024 als antisemitisch bezeichnet).
Wenn ich über die diesjährige Berlinale nachdenke, drängt sich ein Gedanke auf: Das Festival ist nicht mehr wirklich politisch. 2025 wurde die Berlinale vielmehr zu einem Festival der Politiker:innen.
Mit dem Vorwurf konfrontiert, die Berlinale zu einem Raum zu machen, der pro-palästinensische Haltungen ablehnt und gleichzeitig Antisemitismus ins Programm nimmt, scheute Tuttle davor zurück, sich deutlicher zu positionieren. Am Eröffnungsabend entschied sie sich, mit einer Gruppe von Filmschaffenden und Aktivisten zusammenzustehen, die Bilder der Hamas-Geisel David Cunio hochhielten, eines Schauspielers, dessen Film „Youth“ 2013 auf der Berlinale Premiere gefeiert hatte. Ihre Entscheidung, an dieser nicht von der Berlinale organisierten Mahnwache teilzunehmen, ohne eine andere Erklärung abzugeben, wurde von vielen als performativ angesehen. Natürlich lässt sich nicht kritisieren, dass Tuttle an einer Mahnwache für eine Geisel teilgenommen hat, nicht zuletzt mit Blick auf Cunios Verbindung zur Berlinale. Doch das Festival hatte ein ganzes Jahr lang Zeit, sich etwas auszudenken, das nicht nur die Geiseln ehren würde, sondern auch die mindestens 62.000 von Israel getöteten Palästinenser:innen, sowohl in Gaza als auch im Westjordanland.
Ein vom israelischen Kulturministerium finanzierter Dokumentarfilm über David Cunio lief im offiziellen Programm. Ebenso „Holding Liat“ von Brandon Kramer, der sogar den Preis für den besten Dokumentarfilm gewann, auch dies ein Film über Geiseln. Für die Organisator:innen der Berlinale muss es eine Erleichterung gewesen sein, dass „Holding Liat“ den Silbernen Bären als besten Dokumentarfilm gewonnen hat; ein befriedigender Schlusspunkt nach den Kontroversen um „No Other Land“. „Free Palestine“-Rufe und Forderungen, die Besatzung zu stoppen, blieben der Bühne 2025 fern – wenn man die Vorführung von Jun Lis „Queerpanorama“ außer Acht lässt. Dort verlas der Regisseur eine Erklärung seines Schauspielers Erfan Shekarriz, wurde vom Publikum unterbrochen und später von der Berliner Polizei verhört. Nein, bei dieser Berlinale benahmen sich fast alle Gäste, die ihre Filme vorstellten, mustergültig. Nur eine Handvoll Filmemacher:innen wagten es überhaupt, in ihren Q&A-Runden Palästina zu erwähnen. Wenn ich über die diesjährige Berlinale nachdenke, drängt sich ein Gedanke auf: Das Festival ist nicht mehr wirklich politisch. 2025 wurde die Berlinale vielmehr zu einem Festival der Politiker:innen.
Ich habe das Gefühl, dass die Berlinale in diesem Jahr eine Chance vertan hat, indem sie auf ein Sonderprogramm zu Israel und Palästina verzichtete. Wäre es für die Programmverantwortlichen der Berlinale wirklich so schwierig gewesen, eine spezielle Nebenreihe zu kuratieren? Mit Werken wie Jumanna Mannas „Foragers“ oder „From Ground Zero“, einem beeindruckenden Projekt unter der Leitung des palästinensischen Regisseurs Rashid Masharawi, das 22 Kurzfilme von Filmemachern aus Gaza vereint. Beide Werke wurden auf alternativen Festivals wie der „Palinale“ oder der „Falastin Cinema Week“ gezeigt – Veranstaltungen, die als Antwort auf die Berlinale entstanden und parallel zum „größeren“ Festival liefen. Es wäre eine kraftvolle Geste gewesen, solche Werke neben „Holding Liat“ und „A Letter to David“ zur Berlinale einzuladen. Dies hätte ein vollständigeres Bild ermöglicht und blinde Flecken in der Programmgestaltung vermieden – ganz ähnlich wie es die Berlinale bereits erfolgreich bei Themen wie Ukraine oder Iran demonstriert hatte.
„Was haben wir davon, wenn wir fernbleiben und das Feld leer lassen, so dass allein die andere Seite ihre Geschichte erzählt?“
Areeb Zuaiter
Nun, ich sage blinde Flecken, obwohl „Yalla Parkour“, ein palästinensischer Film über Parkour-Athleten in Gaza, in der Panorama-Sektion des Festivals lief und sogar den zweiten Platz bei den Publikumspreisen belegte. Mit der Regisseurin Areeb Zuaiter habe ich über Zoom gesprochen und sie zu ihrer Entscheidung befragt, in einem so zerrissenen Klima am Festival teilzunehmen. „Ich habe den vollsten Respekt vor jedem und jeder, der oder die sich entscheidet, das Festival zu boykottieren“, erklärte sie. „Aber meiner Meinung nach schaden uns kulturelle Boykotte letztlich mehr, als sie uns nützen.“ Sie verwies auf die wenigen Filme über den 7. Oktober, die bei der Berlinale gezeigt wurden, einem Festival, das traditionell ein vielfältiges Publikum anzieht. „Ich möchte nicht, dass dieses Publikum ausschließlich Filme über den 7. Oktober aus einer einzigen Perspektive sieht. Was haben wir davon, wenn wir fernbleiben und das Feld leer lassen, so dass allein die andere Seite ihre Geschichte erzählt?“
Ein Filmemacher, der sich dieses Jahr für einen Boykott der Berlinale entschied, war Abdallah Alkhatib, Regisseur von „Little Palestine, Diary of a Siege“, ein Film, der auch am letzten Tag der „Palinale“ gezeigt wurde. Alkhatib war für das renommierte Berlinale Talents-Programm und dessen Doc Station ausgewählt worden. Dies wäre für ihn eine wertvolle Gelegenheit gewesen, Kontakte zu knüpfen und sich als Filmemacher zu profilieren. Seine Entscheidung, sich zurückzuziehen, war für ihn mit handfesten beruflichen Folgen verbunden. Ich habe Kontakt zu Alkhatib aufgenommen und ihn gefragt, was er sich von der Berlinale gewünscht hätte. „In einem idealen Szenario hätte die Berlinale meiner Meinung nach eine klare Position zu den Ereignissen in Palästina beziehen sollen, ähnlich wie sie es bei der Ukraine getan hat“, schrieb er mir. „Sie hätten eine eigene Plattform für palästinensische Filmemacher:innen schaffen sollen, da wir weniger privilegiert sind und im Vergleich zu anderen Filmschaffenden deutlich weniger Möglichkeiten haben.“
Von den Filmen, die auf dem Festival Premiere feierten, muss ich „Mickey 17“ hervorheben, Bong Joon Hos konzeptionell ambitionierten Nachfolger seines vielfach ausgezeichneten Films „Parasite“. In „Mickey 17“ bekommt ein Mann einen Job, für den er zu sterben bereit ist – buchstäblich. Mickey Barnes heuert als „Entbehrlicher“ an und willigt ein, lebensgefährliche Missionen in einer Weltraumkolonie zu übernehmen, um bei der Entwicklung von Impfstoffen zu helfen, die seinen Mitmenschen zugutekommen sollen. Es sind Missionen, die Mickey nicht überleben soll – genau das ist der Punkt. Nach jedem Tod wird einfach ein neuer Mickey aus einer Maschine „fotokopiert“, als hätte es den Vorgänger nie gegeben. Das geht so weiter, bis der vermeintlich tote, aber sehr lebendige Mickey Nummer 17 dem frisch erschaffenen Mickey 18 plötzlich Auge in Auge gegenübersteht.
Ich finde kaum eine treffendere Metapher für die Internationalen Filmfestspiele Berlin, wo „Mickey 17“ seine deutsche Premiere feierte. Das Festival wurde dieses Jahr 75 Jahre alt, unter normalen Umständen ein Anlass für große Feierlichkeiten. Die Berlinale und die Stadt Berlin möchten uns weismachen, dass tatsächlich lautstark und stolz gefeiert wurde. Doch bei genauerem Hinsehen erkennt man: Die 75. Ausgabe der Berlinale war nur noch ein Schatten ihrer selbst. Eine blasse, weniger aufregende Version des Festivals und vor allem eine, die von den Erinnerungen an ihre Vergangenheit heimgesucht wird. Ganz ähnlich wie der titelgebende Protagonist in „Mickey 17“.
Der Zeitgeist der gegenwärtigen deutschen Politik wurde vor allem von einem Film eingefangen: Marcin Wierzchowskis Dokumentarfilm „Das Deutsche Volk“. Er behandelt den rassistisch motivierten Terroranschlag in Hanau 2020, bei dem ein Rechtsextremist neun Menschen ermordete. Der Film feierte seine Weltpremiere in der Sektion Berlinale Special. Eine Szene darin bleibt mir unvergesslich: Der Oberbürgermeister von Hanau, Claus Kaminsky, ermahnt Emiş Gürbüz, die Mutter eines Opfers. Sie solle Äußerungen wie „Ich hasse Deutschland“ unterlassen – vor allem nicht gegenüber dem deutschen Bundeskanzler. Denn dieses Deutschland, das sie so verabscheue, bestehe aus Menschen, die an ihrer Seite stünden. Kurz nach der Premiere von „Das Deutsche Volk“ auf der diesjährigen Berlinale – und fast genau fünf Jahre nach dem Anschlag – veröffentlichte eine fraktionsübergreifende Gruppe aus SPD-, CDU- und FDP-Politiker:innen eine Pressemitteilung. Darin verurteilten sie Gürbüz’ Worte als „hasserfüllt und respektlos“, weil sie es bei einer Gedenkfeier erneut gewagt hatte, die gut dokumentierten institutionellen Versäumnisse rund um den Anschlag kritisch zu hinterfragen.
Stellen Sie sich vor: Sie kommen nach Deutschland und verlieren Ihren Sohn. Sie sagen Dinge, weil Ihr Sohn kaltblütig ermordet wurde, Sie sagen Dinge, weil Sie wütend sind, Sie sagen Dinge, weil Sie eine trauernde Mutter sind. Sie werden von deutschen Politiker:innen bevormundet, die sich weigern, ihre Fehler einzugestehen. Bei einem großen internationalen Filmfestival wird ein Film über das Schicksal Ihres Kindes gezeigt – ein Film, von dem Sie hoffen, dass er etwas bewirken kann. Mehr Menschen werden jetzt Ihren Schmerz sehen, sie werden sehen, wie Politiker:innen Sie seit Jahren behandeln. Und sie werden eine Pressemitteilung lesen, in der dieselben Politiker:innen Sie zu mehr Respekt und Anstand ermahnen. Sie werden nicht fassen können, wie Politiker:innen so herzlos sein können, Ihnen, einer Mutter, deren Sohn in ihrem Land ermordet wurde, vorzuschreiben, wie Sie zu sprechen und sich zu verhalten haben. Schauen Sie, Sie haben zwar jedes Recht, Ihre Gefühle zu äußern, aber Sie haben den entscheidenden Fehler begangen, diese Dinge deutschen Politiker*innen direkt ins Gesicht zu sagen. Für die werden Sie immer nur ein Gast sein. Und in diesem Land sollten Gäste wissen, dass sie nur zu Gast sind. Wissen Sie nicht, dass es in Deutschland Regeln gibt? In Deutschland hat man sich an diese Regeln zu halten. Die Zeiten, um Freundschaften zu knüpfen, sind längst vorbei. Als Mutter eines Sohnes, der in Deutschland ermordet wurde, sollten Sie das inzwischen wissen.