Der Hausaraber
Übersetzt von Schayan Riaz
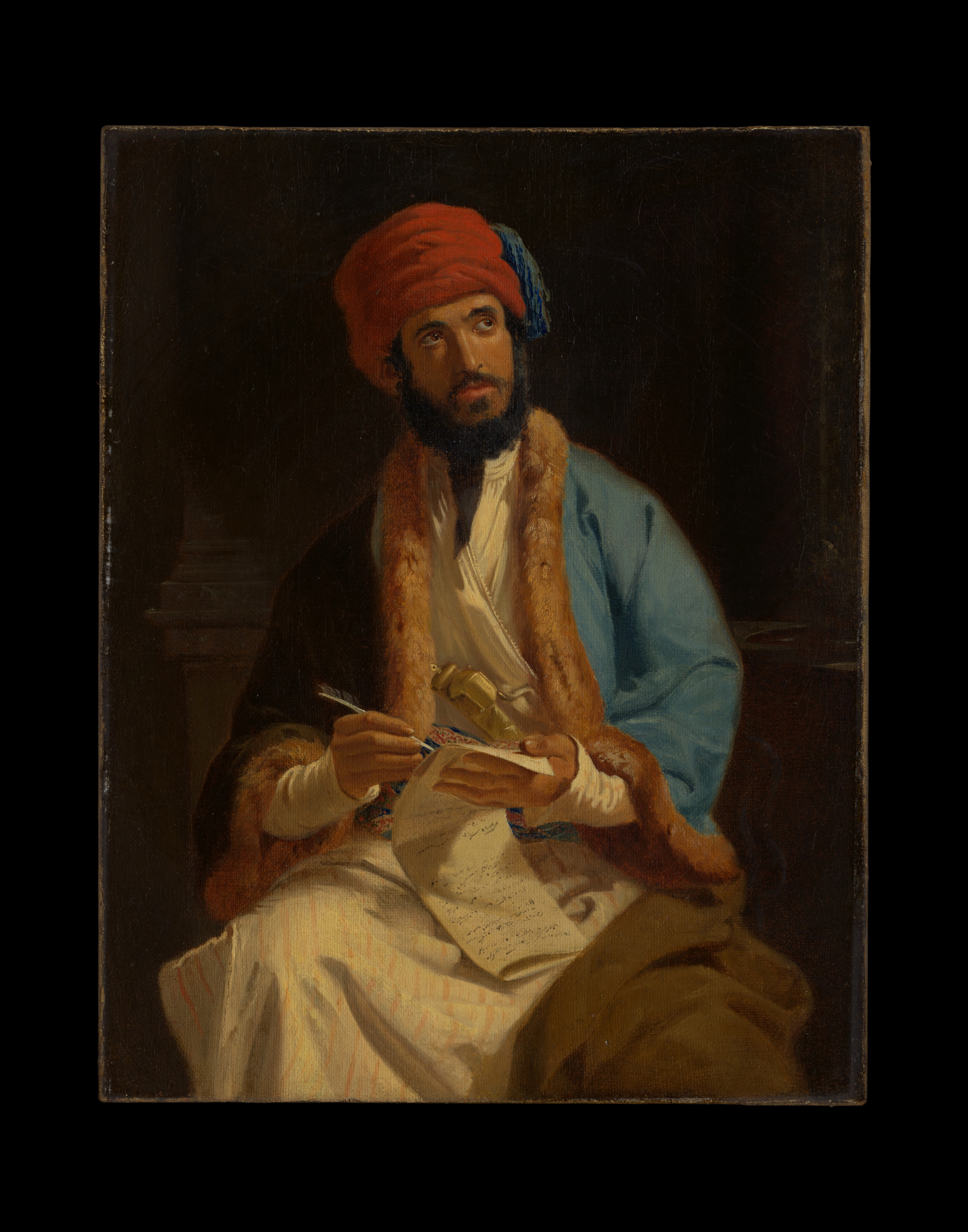
ICH HATTE ALS FACT-CHECKER bei einem Magazin angefangen, und meine Eltern hielten mich endlich nicht mehr für einen Versager. Nicht, weil sie das Heft lasen oder bewunderten, sondern weil der Name des Magazins, wenn sie ihn Freunden oder Verwandten nannten, auf ihren Zungen glitzerte. Ich war zwar immer noch kein Arzt oder Ingenieur, aber die Zeitschrift warf ein schmeichelhaftes Licht auf sie: weltoffen genug, um mir zu gestatten, einen unkonventionellen Weg einzuschlagen – und zugleich streng genug, mich in erhabenste Sphären zu treiben.
Ich selbst ließ den Namen des Magazins auch gern fallen, besonders wenn ich jemandem zum ersten Mal begegnete, aber ich achtete immer darauf, ihn erst dann zu erwähnen, wenn man mich fragte. Fast zwei Jahre lang lief alles glatt. Ich hatte eine Krankenversicherung und verdiente mehr Geld als je zuvor. Im Büro prüfte ich viele der kleineren Texte am Ende des Hefts, was oft bedeutete, während der Arbeitszeit ins Kino zu gehen oder Romane zu lesen. Ich schrieb dann E-Mails mit Korrekturvorschlägen:
Almodóvars Debüt erschien 1980, nicht ’79, wie angegeben, und Penélope Cruz’ Figur hat Sex in den ersten zehn, nicht fünf Minuten des Films. Screenshots mit Zeitstempeln anbei.
Den Rest des Nachmittags verbrachte ich oft in einem Sessel am Fenster und sah hinaus, sah wie das Sonnenlicht über das Wasser der Gedenkstätte des 11. Septembers streichelte. Das Magazin war bevölkert von liebenswerten Sonderlingen, die unerschöpfliches Wissen über Keilschrift oder Tierzucht besaßen und regelmäßig in den Fluren mit anderen zusammenstießen, weil sie, tief über Korrekturfahnen gebeugt, nicht vor sich schauten.
Viele meiner Kolleg:innen rochen förmlich nach Geld: Doppelnamen, Siegelringe, Privatschulen, Prada-Brillen. Auch meine Familie hatte Geld, doch ich glaube nicht, dass ich die Stelle meiner Herkunft verdankte, sondern eher der Tatsache, dass ich Arabisch und Englisch sprechen konnte, ohne einen Akzent, den man hätte verorten können.
Wo immer ich in New York hinging, sah ich unterschiedlichste weiße Menschen, die die Stofftasche des Magazins wie ein Talisman mit sich herumtrugen – wobei ich nie verstand, wogegen sie sich damit eigentlich schützen wollten.
Fact-Checking belohnt genau jene Neurosen, die mich im Privatleben oft unerträglich machen. Im Büro durfte ich ohne Scham darüber reden, warum ich Mahlers Zehnte seiner Neunten vorzog oder woher die faschistischen Details an den Säulen des Grand Army Plaza stammen. Und doch wusste ich, dass manche Dinge nicht durch bloße Exzentrik gedeckt sind. Also tat ich so, als sei mein unterschwelliger Anti-Amerikanismus bloß ironisch – ein Nebenprodukt exzessiver Lektüre kritischer Theorie im College.
Die politische Haltung des Magazins entsprach dem, was in den USA als „linksliberal“ gilt. Der Chefredakteur hatte uns einmal erklärt, die geographische Verteilung unserer Abonnenten entspreche fast exakt Obamas Wahlkarte von 2008. Wo immer ich in New York hinging, sah ich unterschiedlichste weiße Menschen, die die Stofftasche des Magazins wie ein Talisman mit sich herumtrugen – wobei ich nie verstand, wogegen sie sich damit eigentlich schützen wollten.
Es war merkwürdig, von so vielen klugen Menschen umgeben zu sein, die dennoch glaubten, Donald Trumps Wahl sei „überraschend“ gewesen, dass echte Umverteilung des Reichtums politisch undenkbar sei oder dass die Geschichte von Individuen, nicht von Systemen geschrieben werde. Die vorherrschende Meinung lautete: Polizeimorde, CIA-Putsche, geheime Folterlager und institutioneller Sexismus seien bloß Einzelfälle, Ausnahmen vom amerikanischen Normalzustand, der sich – irgendwann, ganz sicher – am Ende des langen Bogens des moralischen Universums selbst korrigieren werde.
Ich schützte mich vor dieser Art Dummheit, indem ich Nachrichten strikt mied. Trotzdem wusste ich: Eines Tages würden Muslime, die den Westen hassten, einige Westler töten, und ich müsste dann zähneknirschend Texte überprüfen, die suggerierten – ohne es je auszusprechen –, dass Araber dem Blutdurst von Natur aus näher seien als andere.
Ich hasste, wie Westler beim Essen immer darauf bestanden, die Rechnung aufzuteilen; wie sie sich weigerten, Verantwortung zu übernehmen für einen Erfindungsgeist, der den Faschismus und die Atombombe hervorgebracht hatte
Ich hasste den Westen auch. Ich hasste, wie Westler beim Essen immer darauf bestanden, die Rechnung aufzuteilen; wie sie sich weigerten, Verantwortung zu übernehmen für einen Erfindungsgeist, der den Faschismus und die Atombombe hervorgebracht hatte, oder für die Hungersnot in Bengalen. Sie stritten in verklausuliertem HR-Sprech und stopften sich fade Speisen in rosige, feuchte Gesichter.
Mein Hass reichte nie bis zum Wunsch nach Gewalt, doch er brachte mich in eine schwierige Lage: Ich konnte nicht „nach Hause“, weil ich kein Zuhause hatte. Ägypten, wo meine Familie lebte, erstickte unter Inflation und Militärherrschaft, während die Vereinigten Arabischen Emirate, wo ich aufgewachsen war, ein Land vertraglich versklavter Arbeitskräfte blieben. Und außerdem – ich wollte Schriftsteller werden. Und Schriftsteller, das wusste ich, lebten in New York.
Der Angriff geschah an einem Samstag, während ich zu Hause saß und versuchte, eine neutrale Rezension über einen schlechten Roman zu schreiben. Als die ersten Meldungen eintrafen – Gleitschirme, Kalaschnikows, ein Musikfestival – ließ ich den Text fallen und verbrachte den Tag online. Ich sah in Echtzeit, wie sich die Deutung verfestigte; bis Sonntagmorgen schien sich alle Welt einig, dass die Ereignisse vom Vortag nur als sinnlose Barbarei zu begreifen seien – oder, vielleicht, als iranisches Komplott –, aber keinesfalls als lesbare Manifestation der Wut eines Volkes, das man hatte sterben lassen.
Ich fühlte mich, als würde ich den Verstand verlieren. Am Nachmittag ging ich mit einer Freundin auf eine Demo und saß bis spät in die Nacht wach, um meine Gedanken aufzuschreiben. Zwei Tage später veröffentlichte ein kleineres, weiter links stehendes Magazin meinen Text. Ich war überrascht über meine eigene Klarheit und ängstlich zugleich, dass ich, was ich in einem Anflug ungesunder Selbstüberhöhung „meine Karriere“ nannte, gerade beendet haben könnte.
Als ich das nächste Mal zur Arbeit ging, zog ich mir die Kapuze tief ins Gesicht, trug Kopfhörer, damit niemand versuchte, mit mir zu reden. Ich war ohnehin mitten in einem schwierigen Stück über Betrug im Handel mit CO₂-Zertifikaten und hätte mich, falls nötig, hinter der Ausrede verstecken können, überarbeitet zu sein – doch das war nicht nötig: In den Fluren wich man mir ohnehin aus.
Menschen verloren ihre Jobs, weil sie einen Waffenstillstand forderten oder Solidarität mit Palästina bekundeten. Ich glaubte, bald einer von ihnen zu sein.
In Palästina fielen bereits Bomben, und die Zahl der Toten stieg täglich. Alles, woran ich denken konnte, waren die zahllosen Weisen, auf die Araber und Muslime im vergangenen wie im laufenden Jahrhundert übergangen, betrogen, vernichtet worden waren – und wie wenig das jemanden zu kümmern schien.
In den USA wurden öffentliche Veranstaltungen, die Israels Politik kritisierten, abgesagt. Menschen verloren ihre Jobs, weil sie einen Waffenstillstand forderten oder Solidarität mit Palästina bekundeten. Ich glaubte, bald einer von ihnen zu sein.
Der Chefredakteur kam an meinen Schreibtisch. Er war – so sagten meine Kollegen und Vorgesetzten stets – ein guter Typ. Er kümmert sich wirklich um uns. Sie nannten ihn Dad. Jeder wusste, dass er Karrieren fördern oder beenden konnte, und alle sehnten sich nach seiner Anerkennung. Wenn er jemanden feuern musste, dann sorgte er dafür, dass wir sahen, wie schwer ihm das fiel. Er sagte oft fuck und shit, kannte die Namen der Kinder seiner Kollegen und trank mit uns denselben billigen Prosecco, wenn jemand eine Auszeichnung bekam oder befördert wurde. Ich war mir sicher, dass er in den Träumen jedes Mitarbeiters mindestens einmal pro Quartal auftauchte.
Einmal hatte er mir anvertraut, er bereue seine damalige Unterstützung des Irakkriegs zutiefst – die größte Fehlentscheidung seiner Karriere, wie er sagte. Er sei eben mitgerissen worden, das musst du verstehen, sagte er, als hätte ich es längst verstanden, von der Stimmung jener Zeit.
Ich begann zu schwitzen, als er sich setzte. Ich dachte, er würde mich feuern – obwohl es seltsam gewesen wäre, das mitten im Großraumbüro zu tun, statt mich in sein eigenes Büro zu bitten.
Ish, sagte er. (Den Spitznamen hatte ich früh angenommen, als klar wurde, dass anglophone Zungen den Laut ‘ayn’ nie richtig formen würden.) Sein Ton war grabesernst. Wie geht’s dir?
Nicht gut, wie du sicherlich weißt.
Es ist einfach so traurig, sagte er. Diese Freude, mit der sie töten. Er ließ den Kopf sinken und schüttelte ihn. Deine Familie – sind sie in Sicherheit?
Da begriff ich, dass er mich nicht tadeln wollte, sondern auf Gemeinsamkeit aus war – mit mir, dem einzigen Araber in der Redaktion. Ich war nicht unberührt von der Geste, auch wenn ich sicher war, dass er wusste, meine Familie sei ägyptisch.
Sie sind in Kairo, sagte ich, weit weg von den Bomben. Aber wir werden sehen, wie sich die Dinge in den nächsten Monaten entwickeln.
So traurig, wiederholte er. Ich verstehe es nicht. Warum sollte die Hamas so etwas tun?
Ich verstand nicht, warum er mich das fragte. Für mich war klar: Freiluftgefängnis war keine Metapher.
Ich weiß nicht, sagte ich. Vielleicht, um aufrecht zu sterben?
Er starrte mich an, entsetzt. Also, ich stimme dem natürlich nicht zu, stotterte ich. Ich sage nicht, dass das gut ist, ich wollte nur—
Das ist schwer für mich zu hören, sagte er. Dann stand er auf und ging. Noch in derselben Woche flog er nach Israel, um über Beerdigungen und Trauer in den Kibbuzim zu schreiben – und irgendwie wurde ich nicht gefeuert.
Ich hörte auf, Filmkritiken zu prüfen, und verbrachte die folgenden Monate damit, zu verifizieren, wie viele Menschen in Palästina gestorben waren – und auf welche Weise. Ich rief Angehörige an, um zu fragen, wie genau ihre Verwandten getötet worden waren. Die Arbeit fiel mir zu, weil keiner der anderen Fact-Checker Arabisch sprach.
Ich war erschöpft. Die Arbeit fraß mich auf, ich schlief kaum noch. Nachts lag ich wach, scrollte durch Twitter, sah Al Jazeera, ließ die Bilderflut von Zerstörung und Tod über mich hinwegspülen, bis ich mich wund und halb wahnsinnig fühlte.
Anfangs erschien es mir wichtig, dass unsere Sprache das Ausmaß des Grauens wiedergab. Doch schon bei diesen schlichtesten Änderungen wurde ich ausgebremst:
von: terrorist → zu: militant
„besetzt“ vor „Westjordanland“ hinzufügen
von „Israels Unabhängigkeitskrieg“ → zu „der Nakba“
Ich schrieb einen kleinen Style-Guide und schickte ihn an die Redaktion, aber ich bezweifle, dass diesen je jemand benutzte. Mit der Zeit spürte ich, wie eine Zielscheibe auf meinem Rücken wuchs, und ich leistete weniger Widerstand. Ich war erschöpft. Die Arbeit fraß mich auf, ich schlief kaum noch. Nachts lag ich wach, scrollte durch Twitter, sah Al Jazeera, ließ die Bilderflut von Zerstörung und Tod über mich hinwegspülen, bis ich mich wund und halb wahnsinnig fühlte. Wenn mich jemand fragte, wie es mir ging, lachte ich. Furchtbar, sagte ich, als wäre das eine Pointe.
Ein paar wohlmeinende Kollegen erzählten mir, einige der älteren Redakteure würden mich inzwischen als Terror-Sympathisanten bezeichnen.
Etwa vier Monate nach Beginn der Offensive gegen Gaza schien sich unter Genozid-Forschern Einigkeit abzuzeichnen: Was in Palästina geschah, war ein Völkermord – das Verbrechen aller Verbrechen. Ich wartete darauf, dass auch unser Magazin das Wort verwendete. Als ich mit dem Chefredakteur darüber sprechen wollte, sagte er, er glaube nicht, dass es sich um einen Genozid handle.
Das auffällige Fehlen des Begriffs ließ mich vermuten, er habe seine Nutzung intern untersagt. Es war ein bemerkenswerter Bruch mit der sonst herrschenden Erkenntnislogik; wenige Monate zuvor hatte ich miterlebt, wie ein anderer Fact-Checker eine Suchtexpertin anrief, um zu verifizieren, dass Glücksspiel tatsächlich süchtig mache.
Aber ich hatte keine Kraft mehr zu kämpfen. Ich redete mir ein, dass die Kriegsmaschinerie sich ohnehin nicht durch eine sprachliche Korrektur in einem Magazin aufhalten ließe, das amerikanische Vorstädter im Badezimmer überflogen.
Ich begann, politische Treffen zur Unterstützung Palästinas zu besuchen. Die Menschen, die ich dort traf, verwechselten Wirklichkeit nicht mit Notwendigkeit – sie glaubten, die Welt könnte anders sein. In kleinen, von Lampen warm ausgeleuchteten Wohnungen, in denen man rauchen durfte, oder in hohen, weiß getünchten Chelsea-Ateliers ließ ich den Blick über die Gesichter wandern, und die Zeit schien stillzustehen. Jede Geste, jedes Wort war mir wie eine Skulptur. Es war – und ich meine das ohne jeglichen Pathos – transzendental: als könnten diese Momente, wenn die Zeit sich wieder in Bewegung setzte, ihrem Verfall entkommen.
Der Artikel konzentrierte sich auf ein Dorf, in dem ein Mann an einem Samstag erschossen worden war, von einem israelischen Soldaten außer Dienst. Ich traf den zuständigen Redakteur auf dem Flur; er sagte, er habe Mühe, das Gleichgewicht zu wahren: Alle Israelis wirken böse, alle Palästinenser wie Heilige.
Irgendwann bekam ich die Aufgabe, einen Text zu prüfen, der von Landraub und einer Serie von Morden im Westjordanland seit dem 7. Oktober handelte – die völlig straflos geblieben sind. Der Artikel konzentrierte sich auf ein Dorf, in dem ein Mann an einem Samstag erschossen worden war, als er Oliven auf seinem eigenen Land pflücken wollte, von einem israelischen Soldaten außer Dienst. Seine Hinrichtung war auf Video festgehalten worden. Die Geschichte zeichnete ein Mosaik aus Siedlern, antizionistischen Rabbinern und palästinensischen Dorfbewohnern, die ihr Leben lang gefürchtet hatten, dass ihnen ihre Häuser genommen würden – und dass, wenn sie getötet oder vertrieben würden, niemand für sie einstehen würde. Ich traf den zuständigen Redakteur auf dem Flur; er sagte, er habe Mühe, das Gleichgewicht zu wahren: Alle Israelis wirken böse, alle Palästinenser wie Heilige. Eine lange Passage, die – ohne redaktionelle Wertung – zeigte, dass die Enteignung der Palästinenser lange vor dem 7. Oktober begann, wurde nach mehreren Auseinandersetzungen zwischen dem Chefredakteur, dem Redakteur und uns – dem Autor und mir – auf einen einzigen Absatz reduziert.
Obwohl die Erschießung des Mannes gefilmt worden war, muss ein Fact-Checker grundsätzlich jede Partei kontaktieren, der ein Verbrechen vorgeworfen wird. Also rief ich den Anwalt des Soldaten an. Er meldete sich aus einem Café, im Hintergrund wummerte Trance-Musik. Ja, sagte er, sein Mandant habe geschossen, und ja, der Mann sei tot. Doch das Militärgericht habe ihn vom Mordvorwurf freigesprochen, da der Getötete ein Terrorist gewesen sei, der mit Steinen geworfen habe. Obwohl das Video nichts dergleichen zeigte, sagte das Gericht, er habe geworfen – also hatte er geworfen. Q.E.D. Sein Mandant habe niemanden ermordet, und es wäre verleumderisch, das zu behaupten.
Als ich auflegte, bat ich einen anderen Fact-Checker, die verbleibenden Anrufe bei den Siedlern zu übernehmen – er willigte ein, und ich war erleichtert. Zwei Wochen lang telefonierte ich mit Palästinensern aus dem Dorf, in dem der Mann erschossen worden war. Sie sprachen Arabisch in einem ländlichen palästinensischen Dialekt, den ich nur schwer verstand, also redeten wir langsam, über viele Stunden, schickten uns gegenseitig Sprachnachrichten über WhatsApp.
Die Menschen, mit denen ich sprach, waren gläubig und doch auf der Suche, sie waren auf eine Weise verloren, die mir vertraut war – doch sie lebten in einer Intensität, der ich nicht gewachsen bin. Zwei von ihnen waren festgenommen, gefoltert und vergewaltigt worden. Ich schämte mich, als ich sie bat, mir ihre Demütigung im Detail zu schildern. Mehrere fragten mich, was sie getan hätten, um das zu verdienen. Sie sagten, sie beteten jeden Tag, dass alle Menschen – selbst die Siedler, die ihre Nachbarn erschossen hatten – in Frieden leben mögen, mit Gottes Segen.
Ich wusste, dass, wenn ich auf diesem Weg bliebe – das minutiöse Katalogisieren der Auslöschung eines Volkes, ohne etwas dagegen zu unternehmen –, die Fakten für mich ihren Sinn verlieren würden.
Zwischen den Anrufen schlich ich in die Bibliothek oder ging auf die Toilette, um zu weinen. Als ich die Überprüfung abgeschlossen hatte, ging ich ins Büro des zuständigen Redakteurs, um meine Anmerkungen abzugeben. Ich saß in einem Sessel, den Blick auf seinen Hinterkopf gerichtet, während er meine Änderungen ins Dokument übertrug.
Als ich an diesem Tag das Büro verließ, spulte ich die letzten Wochen in meinem Kopf immer wieder ab. Ich dachte an die traumatischen Nacherzählungen, zu denen ich meine Gesprächspartner gezwungen hatte, zu keinem anderen Zweck, als dass sie noch einmal litten. Plötzlich spürte ich eine Hand auf meiner Schulter, dann einen Stoß. Ich stolperte gegen den Bordstein.
Du wärst fast vom Bus überfahren worden!
Ich drehte mich um – eine Kollegin stand hinter mir. Hinter ihr raste der BM4-Bus über die Kreuzung an der Church Street, genau dort, wo ich Sekunden zuvor gestanden haben musste. Benommen dankte ich ihr und machte mich zu Fuß auf den Weg zur F-Line am East Broadway, statt den näheren A-Train zu nehmen. Ich hoffte, der lange Spaziergang würde meinen Kopf frei machen.
Der Gedanke kam aus dem Nichts, wie der Impuls, von einem Balkon zu springen: Ich könnte kündigen. Ich könnte gehen, jederzeit. Ich wusste, dass, wenn ich auf diesem Weg bliebe – das minutiöse Katalogisieren der Auslöschung eines Volkes, ohne etwas dagegen zu unternehmen –, die Fakten für mich ihren Sinn verlieren würden. Ich wusste, dass eines Tages, vielleicht in Jahren oder Jahrzehnten, wenn die eine Hälfte Gazas noch in Trümmern läge und die andere aus israelischen Hochhäusern bestünde, das Magazin ein mea culpa veröffentlichen würde. Und vielleicht würde irgendjemand, der daran beteiligt war, es die größte Fehlentscheidung seiner Karriere nennen.
Ich lief das Bahnsteiggleis auf und ab, überlegte, wie ich mein Leben finanzieren würde, wenn ich wirklich kündigte. Mir war schwindlig von der Vorstellung, nie wieder in dieses Büro zurückkehren zu müssen. Ich müsste meine Überzeugungen nicht mehr in höfliche Relativierungen verpacken oder schweigend ekelhafte Dinge anhören, die freundlich vorgetragen waren. Ich fühlte mich frei.
Das englische Original wurde ursprünglich im Magazin Bidoun veröffentlicht.