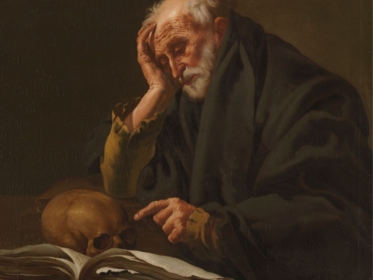Zweierlei Staatsräson
Übersetzt von Schayan Riaz

IM JANUAR 2024 verurteilte der damalige namibische Präsident Hage Geingob die seiner Meinung nach „schockierende Entscheidung“ Deutschlands, Israel in seiner Ablehnung der von Südafrika vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) gegen Israel erhobenen Vorwürfe des Völkermords zu unterstützen. Er wies darauf hin, dass Deutschland im heutigen Namibia den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts begangen habe, bei dem Zehntausende unschuldiger Menschen unter unmenschlichsten und brutalsten Bedingungen ums Leben gekommen seien. Deutschland habe „noch nicht vollständig für den Völkermord gesühnt, den es auf namibischem Boden begangen hat”. Die Entscheidung, Israel zu unterstützen, sei ein weiterer Beweis für „die Unfähigkeit Deutschlands, Lehren aus seiner schrecklichen Geschichte zu ziehen”.
Das Bemerkenswerte an dieser Diskussion war nicht nur, dass Deutschland und Namibia im IGH auf gegensätzlichen Seiten intervenierten, sondern dass Namibia auch eine klare Verbindung zwischen den Ereignissen in Gaza – die es ebenso wie Südafrika als Völkermord betrachtete – und dem Völkermord herstellte, den Deutschland vor hundert Jahren in Namibia begangen hatte. Indem Geingob dieses Kolonialverbrechen auch mit dem Holocaust in Verbindung brachte, warf er Fragen auf, die in den letzten Jahren im Mittelpunkt der Debatten über die Erinnerungskultur Deutschlands standen und seit dem 7. Oktober noch brisanter geworden sind.
Verantwortung für Völkermord
1884 gewährte Reichskanzler Otto von Bismarck einer Niederlassung Schutz, die von einem deutschen Kaufmann namens Adolf Lüderitz gegründet worden war und nach ihm benannt wurde. Diese Siedlung wurde später zu Deutsch-Südwestafrika – eine koloniale Aneignung, die von den europäischen Großmächten auf der Berliner Konferenz von 1884–85 bestätigt wurde. Zwischen 1904 und 1908 führten deutsche Kolonialtruppen einen genozidalen Vernichtungskrieg gegen die widerständigen Herero und Nama, in dessen Verlauf schätzungsweise 50.000 bis 60.000 Herero (bis zu 80 Prozent der gesamten Herero-Bevölkerung) und bis zu 10.000 Nama (50 Prozent) starben. Nachdem der Militärbefehlshaber Lothar von Trotha einen „Vernichtungsbefehl“ erteilt hatte, wurden Tausende in der Omaheke Wüste dem Tod durch Verdursten überlassen. Im ganzen Land wurden Konzentrationslager eingerichtet, um die überlebenden Männer, Frauen und Kinder zu internieren. Nach dem Krieg wurde ein Rassenstaat errichtet, in dem die afrikanische Bevölkerung als Diener der deutschen „Herrenrasse“ dienen sollte.
Deutschland hat die Verwendung des Begriffs „Völkermord“ im Zusammenhang mit seinen Kolonialkriegen lange Zeit abgelehnt. In einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage im Jahr 2012 erklärte die Regierung, dass dies daran liege, dass die Völkermordkonvention der Vereinten Nationen erst 1951 (und im Falle der Bundesrepublik 1955) in Kraft getreten sei und nicht rückwirkend gelte. In der Erklärung hieß es, dass internationale rechtliche Bewertungen „historischer Ereignisse“ nur „unter Anwendung der zum Zeitpunkt dieser Ereignisse geltenden Regeln und Bestimmungen des Völkerrechts und auf der Grundlage der historischen Fakten des jeweiligen Einzelfalls“ vorgenommen werden könnten. Diese Logik würde natürlich auch bedeuten, dass der Holocaust ebenfalls nicht als Völkermord eingestuft werden könnte. Kein Beamter hat sich jemals zu dieser Tatsache geäußert.
Obwohl Deutschland sich verpflichtete, Namibia über einen Zeitraum von 30 Jahren 1,1 Milliarden Euro zu zahlen, wurden diese Zahlungen nicht als Reparationen oder Entschädigungszahlungen, sondern als „Entwicklungshilfe“ bezeichnet. Die deutsche Regierung war nicht bereit, auch nur den geringsten Hinweis darauf zuzulassen, dass sie zu Zahlungen verpflichtet sei.
Vor allem lehnte Deutschland den Begriff Völkermord ab, weil es befürchtete, dass dies eine Verpflichtung zur Zahlung von Reparationen nach sich ziehen würde. Diese Befürchtung prägte die deutsche Politik jahrzehntelang. So erklärte beispielsweise der damalige Außenminister Joschka Fischer 2003 – kurz vor dem hundertsten Jahrestag des Völkermords an den Herero und Nama –, dass er keine „entschädigungsrelevante” Entschuldigung für den Völkermord aussprechen werde. Fischers Aussage verdeutlichte, dass zumindest in diesem Fall die Aufarbeitung der Vergangenheit und die Versöhnung mit den Opfern zweitrangig waren – die deutsche Regierung würde sich nur dann für den Völkermord entschuldigen, wenn dadurch keine Verpflichtung zur Zahlung von Reparationen entstehen würden.
Als Deutschland 2015 Verhandlungen mit der namibischen Regierung aufnahm, bestand ihre Strategie darin, eine offizielle Entschuldigung Deutschlands anzubieten, im Gegenzug dafür, dass Namibia auf jegliche Reparationsforderungen verzichtet. Ruprecht Polenz, ehemaliger CDU-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, wurde zum Sonderbeauftragten für Namibia ernannt. Als er jedoch im November 2016 nach Windhoek in Namibia reiste, warf ihm ein Sprecher der Nama „Arroganz und Unsensibilität vor, die eines Diplomaten nicht angemessen sind“. Er habe seine namibischen Gesprächspartner „ermahnt” und ihnen gesagt, sie sollten die Vernichtung der Nama und Herero nicht mit den Massakern an den Juden vergleichen. „Wir sind überzeugt, dass die Äußerungen von Herrn Polenz ein Zeichen von unverhohlenem Rassismus sind”, sagten sie.
Im Jahr 2021 wurde schließlich eine Einigung mit der namibischen Regierung erzielt. Darin wurde anerkannt, dass „die abscheulichen Gräueltaten, die während der Kolonialkriege begangen wurden, in Ereignissen gipfelten, die aus heutiger Sicht als Völkermord bezeichnet würden” – eine Formulierung, die darauf abzielte, die rechtlichen Konsequenzen einer solchen Anerkennung zu vermeiden und vor allem eine Verpflichtung zur Zahlung von Reparationen zu verhindern. Obwohl Deutschland sich verpflichtete, Namibia über einen Zeitraum von 30 Jahren 1,1 Milliarden Euro zu zahlen, wurden diese Zahlungen bewusst nicht als Reparationen oder Entschädigungszahlungen, sondern als „Entwicklungshilfe“ bezeichnet. Die deutsche Regierung war nicht bereit, auch nur den geringsten Hinweis darauf zuzulassen, dass sie zu Zahlungen verpflichtet sei.
Deutschlands Umgang mit der Verantwortung für Kolonialverbrechen wie dem Völkermord an den Herero und Nama ist letztlich immer noch auf Schadensbegrenzung ausgerichtet und nicht auf Versöhnung mit den Nachfahren der Opfer.
Das Abkommen stieß auf enormen Widerstand, insbesondere seitens der Herero und Nama selbst, die sich von den Verhandlungen ausgeschlossen fühlten, und wurde daher noch nicht ratifiziert. Weitere Verhandlungen wurden hinter verschlossenen Türen fortgesetzt. Im Jahr 2024 deutete die damalige namibische Vizepräsidentin Netumbo Nandi-Ndaitwah, die seit dem 21.3.2025 als Nachfolgerin Hage Geingobs Staatspräsidentin Namibias ist, an, dass nun eine Erhöhung der zugesagten Zahlung von 1,1 Milliarden Euro diskutiert wird – und dass ein nicht näher bezifferter Teil der Zahlung im Voraus geleistet werden soll. Es werde nicht mehr von „Hilfe“ oder „Subvention“ gesprochen, sondern von einem Beitrag zur „Sühne“ oder einem „Sühnefons“. Schließlich verzichte Deutschland auch auf die Formulierung „Völkermord nach heutigem Verständnis”, wobei abzuwarten bleibt, welche rechtlichen Konsequenzen dies haben wird – denn auch ein „Sühnefonds” ist keine Wiedergutmachung.
Deutschlands Umgang mit der Verantwortung für Kolonialverbrechen wie dem Völkermord an den Herero und Nama ist letztlich immer noch auf Schadensbegrenzung ausgerichtet und nicht auf Versöhnung mit den Nachfahren der Opfer. Schließlich wäre das Einzige, was verloren gegangen wäre, wenn der Bundestag den Völkermord an den Herero und Nama anerkannt hätte oder der deutsche Bundespräsident eine Entschuldigung ausgesprochen hätte, ein Verhandlungspfand. Die deutsche Regierung scheint sich nicht ernsthaft darum zu bemühen, sich mit der Massengewalt und dem Völkermord in ihrer eigenen Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen. Vielmehr will Deutschland, auch wenn die Forderungen nach Reparationen immer lauter werden, vor allem eine Haftung für Völkermord vermeiden.
Die „Einzigartigkeit“ des Holocaust als Grundlage der deutschen Staatsräson
Dies ist natürlich eine andere Art von Staatsräson als die, die in Bezug auf Israel geltend gemacht wird – und doch hängen beide zusammen. Mit der Unterzeichnung des Luxemburger Abkommens – des Wiedergutmachungsabkommens, das es 1952 mit Israel und dem Jewish Claims Committee geschlossen hat – hat die Bundesrepublik stets versucht zu verhindern, dass es zu einem Präzedenzfall wird, der Zahlungen für andere Verbrechen erfordern würde, die Deutschland im Laufe seiner Geschichte begangen hat. Die Diskussionen über den Völkermord an den Herero und Nama sind ein typisches Beispiel dafür; die Befürchtungen konzentrieren sich weniger auf Forderungen nach Zahlungen aus den ehemaligen deutschen Kolonien als vielmehr auf solche aus den Ländern, die im Zweiten Weltkrieg zu Deutschlands Feinden zählten – Griechenland, Polen und Russland haben alle Reparationsforderungen gegen Deutschland gestellt.
Die Idee der „Einzigartigkeit” oder Einmaligkeit des Holocaust kann als ein Mittel verstanden werden, um die Folgen dieses Präzedenzfalls einzudämmen und gleichzeitig politisches Kapital aus den Reparationen für den Holocaust zu schlagen – indem man die Verbrechen des Dritten Reiches auf den Holocaust beschränkt und die Lehren, die aus der Nazi-Vergangenheit gezogen werden können, einschränkt. In der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg sahen sich viele Westdeutsche persönlich eher als Opfer denn als Täter: als Opfer des Regimes und seines Geheimdienstapparats, als Opfer des Krieges durch Flucht und Vertreibung aus den Ostgebieten, als Opfer von Vergewaltigungen durch Soldaten der Roten Armee, als Opfer der Bombenangriffe der Alliierten, als Opfer der offensichtlichen „Siegerjustiz”, die ihr Verhalten nachträglich kriminalisierte, und schließlich als Opfer eines angeblich von außen aufgezwungenen „Schuldkults”. Erst ab den 1970er Jahren rückte der Holocaust in den Mittelpunkt der deutschen kollektiven Erinnerung an das Dritte Reich und den Zweiten Weltkrieg.
Die Vorstellung, dass der Holocaust „einzigartig“ ist – oft verbunden mit der Behauptung, dass der Holocaust das „schlimmste“ Verbrechen der Menschheit war –, scheint eine ähnliche Entlastungsfunktion zu erfüllen, wenn sie von nichtjüdischen Deutschen verwendet wird.
Noch 1985 musste Bundespräsident Richard von Weizsäcker in einer berühmten Rede zum vierzigsten Jahrestag des Kriegsendes die westdeutschen Bürger davon überzeugen, dass das Ende des Zweiten Weltkriegs als Tag der Befreiung und nicht als Tag der Niederlage zu sehen sei. Sie akzeptierten dies zum Teil, weil er Deutschen aller Altersgruppen einen Ausweg aus ihrer persönlichen Schuld bot. Indem man den Nationalsozialismus externalisiert, befreit man sich schließlich von etwas, das man selbst nicht ist. Das Bekenntnis zu den Verbrechen, das Ende der 1970er Jahre endlich begann, wurde dadurch erleichtert, dass die jüngeren Westdeutschen zumindest teilweise in der Lage waren, sich von der Seite der Täter auf die Seite der Opfer zu begeben. Obwohl die berühmte Rede von Weizsäcker den historischen Revisionismus ablehnte, tat sie dies, ohne die Mehrheit der Deutschen mit ihrer eigenen Schuld – oder der ihrer Eltern und Großeltern – zu konfrontieren.
Die Vorstellung, dass der Holocaust „einzigartig“ ist – oft verbunden mit der Behauptung, dass der Holocaust das „schlimmste“ Verbrechen der Menschheit war –, scheint eine ähnliche Entlastungsfunktion zu erfüllen, wenn sie von nichtjüdischen Deutschen verwendet wird. Indem die zweifellos monströse Natur des Verbrechens zu einem in der Weltgeschichte einzigartigen Ereignis erhoben wird, wird es implizit von der deutschen Geschichte losgelöst – es wird enthistorisiert. Die Vorstellung vom Holocaust als einem einzigartig bösen Ereignis, das einen “Zivilisationsbruch” darstellt, kann auch als Bruch mit der Geschichte gelesen werden. Der Superlativ „schlimmste“ hat somit den Effekt, dass man sich der Verantwortung entzieht. Aus einer Vielzahl schrecklicher Verbrechen wird eines herausgegriffen. Die ideologische Grundlage des Antisemitismus unterscheidet den Holocaust zwar von anderen Verbrechen. Aber wenn man sich ausschließlich darauf konzentriert, werden andere Verbrechen mit anderen Ursachen in den Hintergrund gedrängt.
In Bezug auf die historischen Ursachen ist die Idee der „Einzigartigkeit“ reduktiv. In Wirklichkeit waren der Nationalsozialismus und der Holocaust das Ergebnis vielfältiger Faktoren, die von sozialen Strukturen bis hin zu militaristischen, imperialistischen und eugenischen Ideen reichten. Doch die Beschwörung der „Einzigartigkeit“ macht die Ideologie – also den Antisemitismus – zur alleinigen Ursache des Holocaust. Gleichzeitig wird der Rest der deutschen Geschichte, soweit er nichts mit Antisemitismus zu tun hat, davon isoliert, da der Holocaust zum ultimativen Verbrechen erklärt wird. Die Folge davon ist, dass, solange Deutschland sich weiterhin für den Schutz des „jüdischen Lebens” einsetzt, andere Lehren aus den Verbrechen des Dritten Reiches in den Hintergrund treten. „Nie wieder“ bedeutet, gegen Antisemitismus zu kämpfen, aber nicht, zum Beispiel, gegen Rassismus.
Es war, als hätte es ein anderes Deutschland gegeben, als wäre allein Hitler für den Nationalsozialismus verantwortlich gewesen, als wäre es nicht auch deutsche Barbarei gewesen.
Die physische Verkörperung dieser Verengung der Lehren aus der Nazi-Vergangenheit ist das Holocaust-Mahnmal im Zentrum Berlins. Der Bau des Mahnmals in den 1990er Jahren stand in direktem Zusammenhang mit der Entscheidung, die Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands von Bonn nach Berlin zu verlegen. Um die Ängste seiner Nachbarn aufzugreifen, wollte Deutschland symbolisch zeigen, dass es sich durch ein „Bekenntnis, dass dieses vereinte Deutschland seine Geschichte anerkennt und dies tut, indem es in seiner Hauptstadt an das größte Verbrechen seiner Geschichte erinnert“, wie es Bundestagspräsident Wolfgang Thierse bei der Eröffnung der Gedenkstätte formulierte. Es ist bezeichnend, dass der Deutsche Bundestag beschloss, dass dieses Denkmal im Zentrum seiner neuen Hauptstadt nur den jüdischen Opfern des Dritten Reiches und nicht allen Opfern gedenken sollte.
So ging die Verlegung der deutschen Hauptstadt von Bonn nach Berlin und die Verlagerung der Macht vom Westen in das alte Zentrum des Deutschen Reiches nicht nur mit einer demonstrativen Anerkennung der eigenen problematischen Geschichte einher, sondern auch mit einer Verengung der Perspektive. Das Denkmal, so Thierse, erinnere an „das schlimmste, das schrecklichste Verbrechen Nazi-Deutschlands“. In Anlehnung an Weizsäckers Formulierung von 1985 bezeichnete er das Kriegsende als „Befreiung unseres Landes und unseres Kontinents von Hitlers Barbarei“. Es war, als hätte es ein anderes Deutschland gegeben, als wäre allein Hitler für den Nationalsozialismus verantwortlich gewesen, als wäre es nicht auch deutsche Barbarei gewesen.
Auch Merkels Rede vor der Knesset im Jahr 2008, in der sie erklärte, die Sicherheit Israels sei deutsche Staatsräson, muss in diesem Zusammenhang gesehen werden. Das Außergewöhnliche an dieser Rede war schließlich nicht ihr Bekenntnis zur Sicherheit Israels – dessen Existenzrecht war bereits seit Jahrzehnten einer der Eckpfeiler der deutschen Nahostpolitik. Vielmehr verband sie dieses Existenzrecht und diese Sicherheit mit der Einzigartigkeit des Holocaust. Merkel rechtfertigte die deutsche Außenpolitik in einem der komplexesten und konfliktreichsten Bereiche der internationalen Politik mit Verweis auf die Verpflichtungen, die sich aus der deutschen Geschichte ergeben, und insbesondere mit der Idee des Holocaust als Zivilisationsbruch, als einzigartiges Ereignis. „Der durch die Shoah verursachte Zivilisationsbruch ist beispiellos“, sagte sie.
Ein neuer Historikerstreit?
Vor dem Hintergrund dieser Verengung des deutschen Verständnisses der nationalsozialistischen Vergangenheit – auch wenn Deutschlands Umgang mit dieser Vergangenheit als vorbildlich gilt – hat in den letzten Jahren eine Debatte darüber stattgefunden, wie das Verhältnis zwischen deutschem Kolonialismus und Holocaust zu verstehen ist. Auslöser dieser Debatte waren unter anderem Artikel, die ich vor mehr als zwanzig Jahren geschrieben habe und die später in meinem Buch „From Windhoek to Auschwitz?“ veröffentlicht wurden. Das Buch erschient bereits 2011, doch erst in den letzten Jahren wurde seine These auch außerhalb der Wissenschaft diskutiert.
Darin argumentierte ich, dass vierzig Jahre vor dem Vernichtungskrieg in Osteuropa und dem Holocaust deutsche Kolonialtruppen in Deutsch-Südwestafrika den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts begangen hatten. Ich untersuchte die Beziehung zwischen Kolonialismus und Nationalsozialismus und nutzte dabei Völkermord, den „Rassenstaat“ und Zwangsarbeitssysteme als Ausgangspunkt für vergleichende Beobachtungen. Ich lehnte eine direkte Kausalität zwischen Deutschlands erstem Kolonialreich (vor 1914) und seinem zweiten (1939–45) ab – die Verbrechen der Nazis waren nicht bloße Kopien dessen, was in deutschen und anderen europäischen Kolonien geschehen war, wie manche argumentiert haben. Ich habe jedoch Entwicklungen identifiziert, in denen koloniales Wissen und koloniale Praktiken aus der imperialen Zeit in die Zeit nach 1933 übernommen wurden. Ich kam zu dem Schluss, dass die Expansion der Nazis nach Osten als koloniales Projekt betrachtet werden sollte.
Die anschließende Debatte über den deutschen Kolonialismus und den Holocaust führte zu einer Intervention von Jürgen Habermas, einer Schlüsselfigur im Historikerstreit der 1980er Jahre. Er fasste die neue Debatte wie folgt zusammen:
Die Kontroverse der letzten Monate dreht sich im Wesentlichen um ein Argument: Wenn man den kolonialen Charakter des Ziels von Hitlers rassistischem Vernichtungskrieg gegen Russland berücksichtigt und wenn man den organisierten Mord an den europäischen Juden in diesem Zusammenhang betrachtet, in dem er entstanden ist, kann man im Völkermord an den Nama und Herero in Südafrika durch die deutsche Kolonialverwaltung jene kriminellen Züge erkennen, die sich im Holocaust in verstärkter und anderer Form wiederholten.
Im Historikerstreit, ausgelöst durch die Behauptung des Historikers Ernst Nolte, der Holocaust sei eine Reaktion auf den sowjetischen Terror gewesen, gehörte Habermas zu denen, die argumentierten, der Holocaust sei einzigartig, und Nolte vorwarfen, den Holocaust zu relativieren. Habermas sieht den Holocaust nach wie vor als „einzigartig“ an. Im Gegensatz zu einigen anderen Teilnehmern der Debatte, die diejenigen diffamieren wollten, die Verbindungen zwischen dem Holocaust und kolonialen Verbrechen herstellen, indem sie unterstellten, dass diese den Holocaust ebenso relativierten wie Nolte, räumt Habermas ein, dass die Situation heute eine ganz andere ist als in den 1980er Jahren:
So wie alle historischen Fakten mit anderen Fakten verglichen werden können, kann auch der Holocaust mit anderen Völkermorden verglichen werden. Aber die Bedeutung des Vergleichs hängt vom Kontext ab. Im Historikerstreit ging es darum, ob der Vergleich des Holocaust mit den stalinistischen Verbrechen die später geborenen Deutschen von ihrer politischen Verantwortung für die Massenverbrechen der Nazis entbinden könnte … Heute, unter anderen Umständen, geht es nicht um eine Entlastung von dieser Verantwortung, sondern um eine Verlagerung des Schwerpunkts.
Ich denke, Habermas hat den Punkt etwas verfehlt. Zumindest für mich geht es nicht um eine „Verschiebung des Schwerpunkts”, sondern vielmehr um ein besseres Verständnis seiner Ursprünge und der Traditionen, die den Mord an Juden und den Vernichtungskrieg begünstigten. Auf diese Weise kann eine pauschale „Einzigartigkeit”, die für Entlastungszwecke missbraucht werden kann, durch die weitaus produktivere Frage ersetzt werden, was am Holocaust einzigartig war und was nicht. Dies würde dem Antisemitismus seinen rechtmäßigen Platz einräumen, ohne die allgemeine, systemische Natur der Gewalt zu ignorieren oder zu entschuldigen. Es würde die Geschichte des Antisemitismus mit der Geschichte des Völkermords verbinden, insbesondere in Deutschlands Jahrhundert der Gewalt.
Während die Opfer des Nationalsozialismus und der DDR einen Platz im Zentrum der deutschen Erinnerungskultur verdienen, gilt dies offenbar nicht für die Opfer des Kolonialismus.
Deutschland scheint jedoch noch nicht bereit dafür zu sein – oder vielleicht ist es angesichts der seit den 1980er Jahren stattfindenden Verengung des Verständnisses der nationalsozialistischen Vergangenheit genauer zu sagen, dass es nicht mehr bereit ist. Ein Beispiel dafür ist das Scheitern des Versuchs der aktuellen Regierung, ihren Ansatz zur Erinnerung an deutsche Verbrechen zu erweitern. Als die deutsche Kulturministerin Claudia Roth versuchte, den offiziellen Ansatz der deutschen Regierung zu modernisieren, indem sie den Kolonialismus mit einbezog, stieß sie auf massiven Widerstand seitens der bestehenden Institutionen, die sich auf den Holocaust und die Verbrechen der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) konzentrieren. Roth, die bereits während der Kontroversen um die Documenta 15 und die Berlinale 2024 des Antisemitismus bezichtigt worden war, gab nach.
Infolgedessen wurde die geplante Reform verworfen und beschlossen, den bestehenden Ansatz fortzusetzen. Obwohl unvermeidlich Lippenbekenntnisse zu den „anderen wichtigen Themen” abgegeben wurden, die separat diskutiert werden sollten, hätte die Hierarchie der Verbrechen – und damit auch der Opfer – nicht deutlicher sein können. Während die Opfer des Nationalsozialismus und der DDR einen Platz im Zentrum der deutschen Erinnerungskultur verdienen, gilt dies offenbar nicht für die Opfer des Kolonialismus. Indem sie zunächst die Notwendigkeit anerkannte, Kolonialverbrechen einzubeziehen, und dann angesichts des Widerstands einen Rückzieher machte, hat Roth den zweitklassigen Status der Opfer des deutschen Kolonialismus klar festgelegt. Dies läuft auf nichts weniger hinaus als eine Relativierung des Völkermords an den Herero und Nama.
Die Verweise und Belege zu diesem Artikel finden sich in der englischen Originalversion des Beitrages: Jürgen Zimmerer, Two Kinds of Staatsräson: The Holocaust and German Colonialism, in: Hans Kundnani (ed.); Hyper-Zionism. Germany, the Nazi Past and Israel, Verso, London 2025.