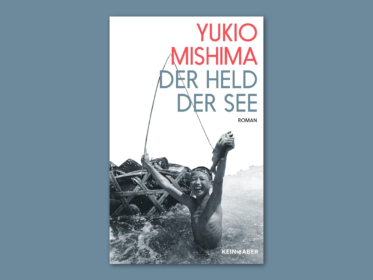Westwärts, durch die Luft
Übersetzt aus dem Hebräischen von Lucia Engelbrecht
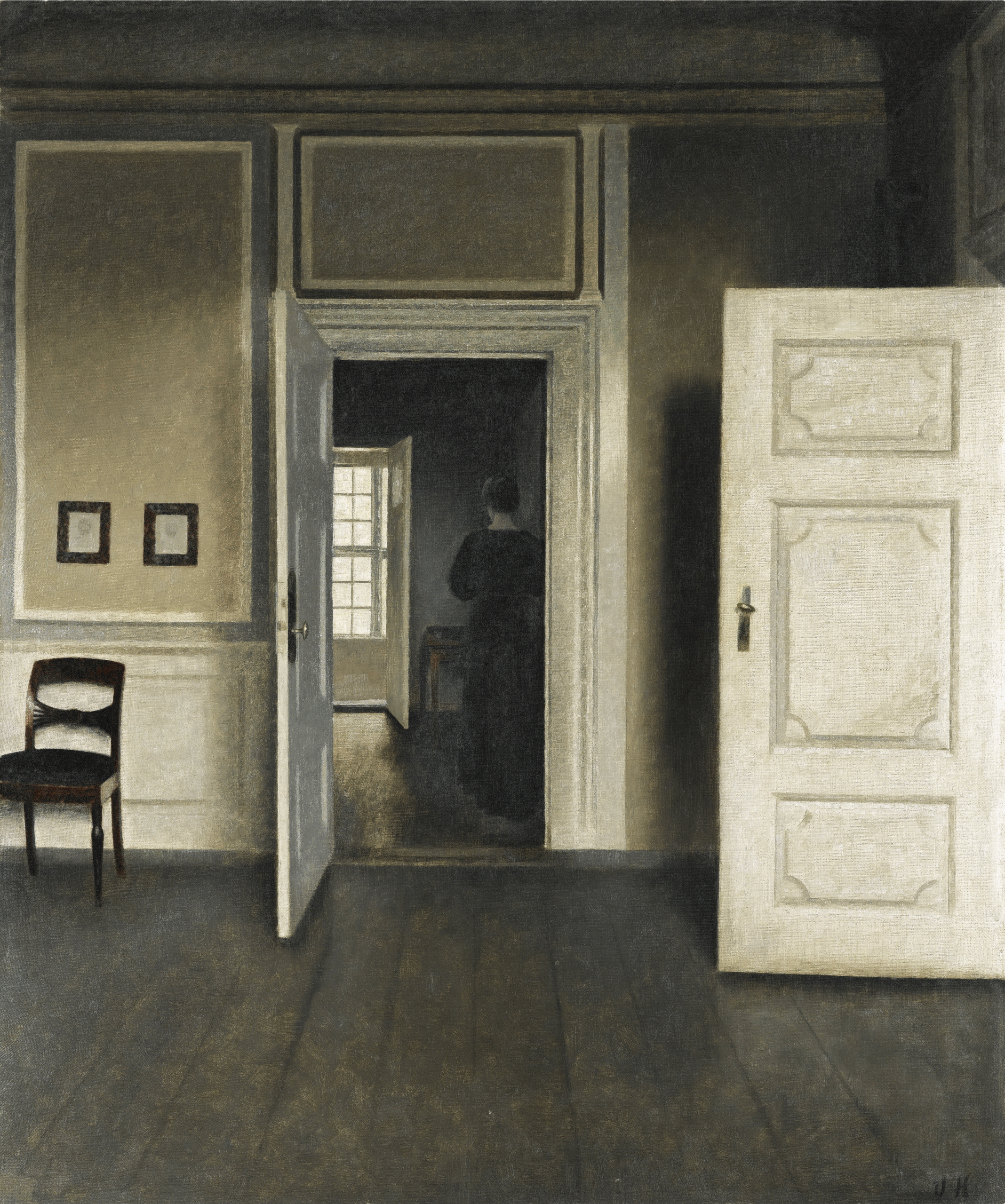
Danielle, die Erzählerin in Tamar Raphaels Kurzgeschichte Westwärts, durch die Luft ist erst kürzlich mit ihrem Partner Daniel von Tel Aviv nach Berlin gezogen. Sie besucht einen Deutschkurs, der von einer Frau namens Daniela unterrichtet wird. Diese Namen sind nur eine von mehreren Spiegelungen und Verschiebungen im Text: zwischen Schülerin und Lehrerin, Deutsch und Hebräisch, Tür und Spiegel, Ich und Du.
Danielles Reise spiegelt eine gesellschaftliche Realität wieder: Berlin ist seit Jahren zu einer Heimat für linke Israelis geworden, die dort in beachtliche Zahl Zuflucht gesucht haben. Raphael setzt genau hier an und pendelt zwischen harten politischen Gegebenheiten und Danielles eigener, bürgerlicher, sanft ironischer Weltsicht. Die Geschichte wird in Sätzen erzählt, die zwischen Vergangenheit und Gegenwart sowie der inneren Welt und Beobachtungen mäandern. Sie handelt auch vom Zuhören und Nicht-Zuhören, vom Sprechen und Nicht-Sprechen.
Raphaels Debütroman, There Were Two With Nothing To Do, der einen Blick in linksgerichtete soziale Kreise in Tel Aviv wirft, erschien 2024 auf Hebräisch und wurde von der Kritik gefeiert. The Diasporist freut sich, die allererste Übersetzung eines Texts von Tamar Raphael sowohl ins Englische als auch ins Deutsche zu veröffentlichen.
Die Wohnung im Zentrum Tel Avivs, die wir verließen, war ein blasser Abklatsch der Wohnung, die wir ein Jahr zuvor in Jaffa hatten verlassen müssen, und die Wohnung, die wir in Berlin gefunden hatten, war eine Bruchbude, und trotzdem schätzten wir uns glücklich, denn schließlich hatten wir eine Wohnung in Berlin gefunden. Sehr gut, sagte ich nach den katastrophalen Ergebnissen der November-Wahlen, als mehr und mehr Leute davon sprachen, das Land zu verlassen, wir müssen jedenfalls nicht am Flughafen Schlange stehen. Wir konnten sagen, dass wir es hatten kommen sehen, und sogar mit Recht, in Daniels Fall wenigstens. Die Wahrheit war, wenn man uns nicht aus der Wohnung in Jaffa geworfen hätte, hätten wir die Stadt nicht verlassen. Zu jener Zeit, als unsere Vermieterin aus ihrer schicken Reha-Einrichtung in Miami anrief und uns mitteilte, dass sie die Wohnung in Jaffa an französische Investoren verkauft habe und uns deshalb rauswerfe, arbeitete ich im Fotoarchiv einer Zeitung. Statt meine eigentliche Arbeit zu tun – endlos Bilder von Passanten mit OP-Masken, die an geschlossenen Restaurants vorbeigehen, zu verschlagworten – sah ich mir Fotos des Rückzugs aus Gaza von 20051 an und schickte sie Freunden auf WhatsApp: Bilder weinender Frauen, die sich aneinanderklammern, sich an dem festhalten, was von ihrem Zuhause übriggeblieben war, die von Soldaten gepackt werden, deren Körper vor lauter Widerständigkeit fast aus den Klammergriffen zu platzen scheinen. Schubweise schickte ich die Bilder an meine Freunde und schrieb dazu “That’s me“, denn ich konnte sie nicht weiter um Mitleid bitten, nachdem ich das tagelang getan hatte; aber um einen Lach-Emoji konnte ich schon bitten, und konnte ihn auch bekommen, aber dafür musste ich mich selbst lächerlich machen, und das wollte ich auch, denn ich wusste ja, wer die Menschen waren, die in diesem Land wirklich die ganze Zeit über gewaltvoll und ungerechterweise aus ihren Häusern vertrieben werden, und das waren bestimmt nicht die Siedler aus Gush Katif, und das waren auch nicht wir. Es stand uns nie zu, irgendeine eigene Tragödie in diesem Land für uns zu beanspruchen, am allerwenigsten in Jaffa, auch in Nord-Jaffa nicht, selbst am Rand von Jaffa nicht, und trotzdem weinte ich, als würde meine Welt in sich zusammenbrechen, so wie die Siedler aus Gush Katif geweint hatten, die wir damals verspotteten, die wir noch immer verspotten und für alle Zeiten verspotten werden.
Aus unserem Schlafzimmer in Jaffa hatte man ein Stück Meer sehen können, und eine riesige Palme, die im Innenhof stand. Und schiefe Dächer mit zerbrochenen Ziegeln, von denen ich nicht gewusst hätte, wie ich über sie hätte denken sollen, wenn sie nicht in Liedern besungen worden wären; Lieder, die ich hunderte Male gehört hatte. Eine Dachterrasse über der Stadt, langsam bröckelt der Putz herab, singt Josie Katz, und Korin Allal Unterm schiefen Dach, ein kleines Kämmerchen. In der fernen Vergangenheit hatten mich solche Lieder glauben lassen, es gäbe ein Leben, das immer so aussieht, bröckelnd, schief und in Liedern besungen, und ich war der Meinung, dass ich, wenn ich mal groß wäre, dieses Leben an den Rändern der Welt suchen würde, doch ich hatte nie den Mut, bis an den Rand zu gehen. Aus dem nach Osten gerichteten Wohnzimmer hatte man auf eine Allee geblickt, und auch auf ihr waren die Bäume riesig – keine Palmen, vielleicht Maulbeerfeigenbäume, behaupte ich vorsichtig, denn von Bäumen habe ich keine Ahnung, und trotzdem denke ich, dass es alte, dicke und sehr grüne Maulbeerfeigenbäume waren. Weniger grün waren die Baumkronen der Allee, die wir vom Fenster unserer nächsten Wohnung sehen konnten, im Zentrum Tel Avivs. Auf der Suche nach einer neuen Bleibe wurden wir auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und Tatsache war, so sagten die Immobilienmakler der Stadt, dass die Welt Kopf stand. Vergesst alles, was ihr über das Leben wisst, sagten sie, Jaffa ist heutzutage teurer als Tel Aviv Zentrum. Die neue Wohnung musste also ein blasser Abklatsch der alten sein. Vom Schlafzimmerfenster aus konnten wir das Meer nicht mehr sehen. Vom Wohnzimmerfenster aus sahen wir eine andere Allee mit anderen Maulbeerfeigenbäumen, aber sie waren nicht dick, nicht alt, nicht grün. Wären sie nur ein klein wenig grüner gewesen, hätte ich Daniel vielleicht davon überzeugt, dass sein akademisches Potenzial unser Weggehen nach Berlin nicht rechtfertigt, und wir wären nicht in dieser Wohnung in Neukölln gelandet, die jetzt unser Zuhause ist – eine Wohnung, in der man, um ein Stückchen Himmel zu sehen, den halben Körper aus dem Fenster hängen und sich fast den Nacken brechen muss. Unseren ganzen ersten Winter über hatte ich behauptet, mein einziger Wunsch sei es, nur einen einzigen ordentlichen und bedeutsamen Satz formulieren zu können, aber in Wahrheit wollte ich auch eine schöne Wohnung mit Aussicht auf einen Kanal, in die sich manchmal auch ein Sonnenstrahl verirrt, denn in unserer Wohnung brannte die UVB-Lampe auch im Sommer; und in dieser Dunkelheit ließ mich Daniel allein, ein Jahr später, als er für einen ganzen Monat nach Los Angeles flog, um Gast an einem Forschungsinstitut zu sein, das sein akademisches Potenzial überschätzte und so falsche Hoffnungen in ihm geweckt hatte – Hoffnungen, die bald zerplatzen sollten; und die erste Nebenwirkung dieses Zerplatzens war eine völlige Grenzverschiebung dessen, was man zu Daniel sagen durfte und was nicht; er wurde einer jener Menschen, die schnell beleidigt sind, in einer Welt voller schnell beleidigter Menschen, nachdem er jahrelang völlig immun gegen jede Art von Beleidigung gewesen war, was ich gerne ausgenutzt hatte. „Du liebst es, mich vor anderen zu beleidigen“, hatte er immer gesagt, „du hast Glück, dass ich so gut einstecken kann.“ Und ich hatte stets geantwortet, dass er Glück habe, zu sein, wer er war, und dass ich Glück habe, mit ihm, so wie er war, zusammen zu sein; soll heißen, er hätte hundert Prozent Glück und ich fünfzig, und ich würde nur so gut es geht versuchen, mein Glück zu genießen, was de facto seines war. Doch letzten Endes blieb auch dieses Glück nicht unberührt, auch dieses Glück schwand mehr und mehr, nachdem Daniel verstanden hatte, dass er niemals Professor sein würde und dass wir die vertraute Stadt und die Wohnung in der vertrauten Stadt umsonst verlassen hatten, die Wohnung mit den Baumkronen im Fenster, auch wenn sie nicht grün genug gewesen waren, und dass wir umsonst in eine Stadt ohne Charisma und in eine Wohnung ohne Fensterblick gezogen waren, in der es immer dunkel war. In diese Dunkelheit kehrte ich nach den Hebräischstunden zurück, die ich im Institut für Erwachsenenbildung gab, nicht weit vom Rosenthaler Platz entfernt, in einer Gegend, in der ich zuvor als Touristin Klamotten gekauft oder mir zeitgenössische Kunst angesehen hatte; und aus dieser Dunkelheit ging ich jeden Morgen zum Deutschunterricht in einer Sprachschule an der Warschauer Brücke. Als Touristin hatte ich gedacht, dass die Warschauer Brücke einen gewissen Charme hätte, denn ich war nur zu ihr gegangen, um zu einem Karaoke-Club zu kommen, um mit anderen zu singen, nachts, mit Freunden oder mit Fremden, um Gin Tonic zu trinken und stundenlang zu singen, gemeinsam einen 90er-Jahre-Pop-Hit nach dem nächsten zu verschlingen und ein unbekanntes Lied in die Liste zu schmuggeln, bei dem niemand sonst mitsingen kann und die Bühne nur mir gehört, nur um dann sehen zu müssen, wie die anderen aus der Karaoke-Box gingen, um mehr Gin Tonic zu kaufen, und mich allein ließen, um an dem unbekannten Lied zu ersticken. Das war, was ich als Touristin an der Warschauer Brücke getan hatte. Ich hatte nicht bemerkt, dass sie eigentlich unheimlich war, dass Junkies im Stehen auf ihr einschliefen. Erst als gemeldete Einwohnerin, erst als Deutschschülerin, die jeden Morgen im Sommer 2022 dorthin fuhr, bemerkte ich, dass sie ein Ort war, an dem die Wirklichkeit ihr wahres, beinahe schon faules Gesicht zeigte, und beim Überqueren der Brücke versuchte ich immer, so zu tun, als mache mir das nichts aus, als gäbe es für mich keinen Unterschied zwischen Gold und Rost, als wäre meine Wohnung kein Zufluchtsort, in dem ich mich vor dem hässlichen Anblick der Warschauer Brücke versteckte, sondern nur ein Ort, an dem ich meiner Arbeit nachging, der Arbeit, die mir auferlegt wurde: die zu sein, die ich war; ein Mensch mit dem mir zugeteilten Glück zu sein, ein Glück, nicht besser oder schlechter als das Glück des Obdachlosen mit dem Kinn auf dem Geländer, mit den geschlossenen Augen, der, wenn er sich für einen Moment im Halbschlaf rühren sollte oder träumte, jemand würde ihn verfolgen, vielleicht auf die Bahngleise fällt, vielleicht genau in dem Augenblick, in dem die Bahn einfährt, aus der ich jeden Morgen ausstieg, um zum Sprachinstitut zu gelangen, das am Ende der Brücke zwischen dem Karaoke-Club und einem großen Süßigkeitenladen lag. Dort war ich Migrantin unter Migranten. Wir alle hatten genug Geld, um den Sprachkurs zu zahlen, und genug Zeit, um ihm täglich drei Stunden zu widmen. Andere Aspekte unseres Glücks und Schicksals wurden dort beiseitegeschoben, wir wurden zu Gefäßen für Vokabeln, die grammatikalischen Strukturen stapelten sich in uns aufeinander, und wir sollten auf sie Acht geben, als wären sie ein Turm aus Tellern und man hätte uns aufgetragen, sie durch die Straßen der Stadt zu balancieren, ohne dass sie herunterfallen dürften, doch es war nicht gesagt, dass wir sie jemals an einem Tisch anrichten und von ihnen essen würden. Die Lehrerin hieß Daniela, und sie sah mir sehr ähnlich. Wenn ich erst ein Foto von ihr und dann eines von mir in einer App hochgeladen hätte, die nach Ähnlichkeiten mit Promis sucht, hätten wir sicher dieselbe Liste von Schauspielerinnen erhalten, von denen kein Mensch je gehört hat. Man hätte uns leicht verwechseln können, wäre sie nicht aus Bayern gewesen und ich aus Tel Aviv, wie ich es immer meinen Schülern erzählte, statt zu sagen, ich sei aus Israel. Daniela erzählte nicht, dass sie aus Bayern kommt, aber in der ersten Stunde fragte ich ChatGPT unter dem Tisch: „Wo in Deutschland rollt man das R?“ und es antwortete: „In Bayern“. Später fragte ich ChatGPT, welche bekannten Stereotype es über Bayern gibt. Ich fragte, ob die Bayern es – dem Klischee nach – hassen, wenn man sie korrigiert. Ich fragte, ob es irgendwo auf der Welt überhaupt eine Gruppe gibt, auf die ein solches Klischee zutrifft. Gibt es nicht, sagte ChatGPT. Und trotzdem war Danielas Kränkung, als ich sie korrigierte, so offensichtlich, dass die ganze Klasse sich für ein paar Tage von mir abwandte, und ich empfand das als undankbar, schließlich hatte ich sie nicht meinetwegen, sondern ihretwegen korrigiert. Ich hatte gewusst, dass es keine eigene Infinitivform für das Präteritum gibt, schließlich ist „Infinitiv“ ein universeller Begriff, dem auch das komplizierte deutsche Grammatiksystem nicht seinen Sinn rauben kann. Ich wusste, dass Daniela – aufgrund der identischen Formen des Infinitivs und der Verbformen für „wir“ und „sie“ im Präsens Plural – aus der Pluralform des Präteritums einen eigenen Infinitiv abgeleitet hatte, und ich wusste, dass sie damit eine ganze Klasse in die Irre führte, und nicht nur ihren Schülern, sondern auch sich selbst eine Falle stellte, denn ich wusste, welchen Preis eine verwirrte Lehrerin für eine verwirrte Klasse zahlt. Aber die anderen Schüler wussten das nicht. Auch Lin nicht, die ganze zwei Wochen neben mir gesessen hatte, während derer ich begonnen hatte, den Geruch des Öls zu mögen, das sie sich mehrmals in der Stunde auf das Handgelenk träufelte. Lin ging mir aus dem Weg, nachdem ich Daniela korrigiert hatte. Nach ganzen zwei Wochen, die sie neben mir gesessen hatte, wechselte sie den Platz. „Du hast Platz gewechselt“, sagte ich zu ihr, als ich ins Klassenzimmer kam. „Ja“, antwortete sie, „manchmal muss man den Platz wechseln, damit sich das Glück neu ausrichtet. Auf Arabisch haben wir da so ein Sprichwort.“ Ein paar Tage zuvor hatte sie mir noch erzählt, sie bewundere Neturei Karta.2 Ich hatte gedacht, ich hätte mich verhört, und hatte sie gebeten, sich zu wiederholen, und sie hatte mir ungeduldig erklärt, dass es einen Mann namens Neturei Karta gebe, dem sie auf YouTube folgt, und als neo-traditionelle Muslima fände sie seinen spirituellen Weg inspirierend. „Einen Mann namens Neturei Karta?“, hatte ich sie gefragt, und sie antwortete, es würde sich um den Anführer einer sehr wichtigen spirituellen Gruppe handeln, und tadelte mich: „Du kommst aus Israel und hast noch nie von Neturei Karta gehört?“ Ich hätte Lin sagen sollen, dass ich Neturei Karta schon kannte, als sie noch Windeln getragen hatte und mit ihrer Familie von Damaskus nach Doha geflogen war, meinen Berechnungen nach zu Beginn der großen Dürre, falls sie je von der Dürre gehört hatte, aber dass Neturei Karta nicht der Name einer Person war. Ich sagte es nicht, denn Lin war nicht die Lehrerin und ich musste niemanden vor ihrem Fehler schützen. Ich hatte sie nur gefragt, ob sie sicher sei, dass es der Name einer Person ist. „Er ist so charismatisch und interessant“, sagte sie. Ich habe keine Ahnung, von wem sie gesprochen hat. Später hatte sie mir Früchte angeboten, immer wieder, bis zu dem Moment, in dem ich Daniela korrigierte – danach setzte sie sich an einen anderen Platz, und ich sprach mit niemandem mehr, bis Muhammed in unsere Klasse kam: Nicht nur mitten im Semester, sondern an seinem ersten Tag auch noch zu spät. Weil er zu spät war, wurde Muhammad gebeten, nur kurz seinen Namen zu nennen und zu sagen, woher er kommt, ohne weitere Details, ohne dass wir ihm Fragen stellen mussten, wie es bisher üblich gewesen war, wenn neue Schüler dazugekommen waren. Für einen Moment hoben wir die Augen von den Übungsheften, und er sagte nur: „Muhammad, Palästina“, und Daniela sagte: „Na wunderbar, dann haben wir in der Klasse ja zwei Pakistaner“, denn so war Daniela, nervös und verwirrt bis zur Unaufmerksamkeit. Oft sagte sie Genau zu einem Fehler und Leider nicht zu einer richtigen Antwort. Außerdem hatte die Unterscheidung zwischen Palästina und Pakistan nicht dieselbe Brisanz für sie wie für mich und Muhammad. „Kennt ihr euch?“, fragte sie Muhammad und Rama, die echte Pakistanerin, und zeigte auf beide, doch weil Muhammad zu höflich war, um sie zu korrigieren, sahen Rama und er sich nur an und sagten beide „Nein“. Ich freute mich über Muhammads Anwesenheit, denn er war groß und gutaussehend, trug ein weißes Hemd von Muji und eine glänzende Brille in Schildpatt-Optik. Daniels lange Reise zeichnete sich bereits am Horizont ab und die Anwesenheit eines großen, gutaussehenden, gut gekleideten Mannes mit intensiver Ausstrahlung half dabei, mir vorzustellen, wie sich Raum und Zeit sich entzerrten und sich zusammen mit anderen Faktoren zur Möglichmachung eines möglichen Betrugs an Daniel fügen könnten. Für Muhammad hätte ich meinen Platz im Klassenzimmer gewechselt. Ich plante, in der Pause zu ihm zu gehen, ihm die Hand zu reichen und zu sagen: „Schön, dich kennenzulernen, ich komme aus dem besetzten Palästina“, als hätten meine Freunde und ich nicht endlos über exakt diesen Satz hergezogen, wenn wir ihn aus dem Mund von Bekannten gehört hatten, denn wir sahen in ihm mehr als nur das Zurschaustellen von moralischer Überlegenheit, wir fanden ihn aufgesetzt, geheuchelt. Ich plante, Muhammad zu fragen, warum er Daniela nicht korrigiert hatte, warum er nicht gesagt hatte: „Nicht Pakistan. Palästina.“ Ich plante, mich mit ihm über Daniela lustig zu machen, ihn auf meine Seite zu ziehen, ihn vor ihr zu warnen. In der Pause aß ich eine Tüte Marshmallows vom großen Süßigkeitenladen neben dem Sprachinstitut für Deutsch und dem Karaoke-Club, weil ich am Morgen, wie üblich, das Kommende vergessen hatte – die Mittagszeit – und keinen abgepackten Salat im Supermarkt gekauft hatte. Anstatt meine Süßigkeiten wie sonst im leeren Klassenzimmer zu essen, saß ich auf einem unbequemen Stuhl im Flur, damit Muhammad mich sehen würde, wenn er von seiner Raucherpause zurückkam. Und so geschah es. Von der Raucherecke kommend ging er durch den Flur. Ich sah ihn an, er sah mich an. Er sagte: „Guten Appetit.“ Ich sagte: „Danke.“ Ich nahm einen Marshmallow aus der Tüte und bot es ihm an. Er lehnte es mit einer kaum merklichen Geste ab, blieb aber neben mir stehen, und ich hatte nicht den Mut, das zu sagen, was ich geplant hatte, zu sagen. Ich sagte nicht: „Schön, dich kennenzulernen, ich komme aus dem besetzten Palästina.“ Ich sagte: „Ich glaube, ich habe dich vorhin nicht richtig gehört. Woher kommst du?“
„Aus Pakistan“, antwortete er. „Und du?“
Weder aus Mut, noch für Muhammad oder für die, die es vor mir gesagt hatten, und auch nicht für Palästina, sondern aus einer Niederlage heraus, aus Lust auf die Niederlage, sagte ich, dass ich aus dem besetzten Palästina komme. Er wirkte verwirrt. Aufgewühlt. Er wirkte, als hätte er zu jedem Aspekt des Themas sehr viel zu sagen, doch er fragte nur – plötzlich auf Deutsch, obwohl das Gespräch bis dahin auf Englisch geführt worden war – ob ich Adi kenne. „Ich kenne viele Adis“, sagte ich auf Deutsch, und er fragte auf Deutsch: „Viele Adis?“, und ich kam nicht dazu, zu antworten, denn Daniela schloss die Tür. So machte sie das immer, selbst wenn wir direkt vor der Tür standen. Nie sagte sie: „Kommt rein.“ Hätte sie „Kommt rein“ gesagt, wie ich es jeweils zehn Sekunden vor Ende jeder Pause zu meinen Schülern sagte, hätten wir sicher geantwortet: „Einen Moment bitte“, so wie meine Schüler mir immer antworteten. Daniela hingegen schloss einfach die Tür. Das kränkte uns, und aus dieser Kränkung heraus gingen wir immer sofort zur geschlossenen Tür und öffneten sie. Am Tag, an dem Muhammad zu uns kam, reifte der Entschluss in mir, es Daniela in meinem eigenen Unterricht gleichzutun, und so kam es, dass ich meine liebe Schülerin Bianca zum ersten Mal kränkte; eine bekannte Literaturkritikerin, die aus dem italienischen Friaul nach Berlin gezogen war, sich aber weigerte, der Klasse zu erzählen, warum; und die es sehr genoss, wenn jeden Monat neue Schüler dazukamen, die sie in einfachster hebräischer Syntax fragten, warum sich jemand so etwas antut. Biancas Gesicht war rot, als sie die Tür öffnete, die ich zugeschlagen hatte, während ich gesehen hatte, wie sie mit einem leichten Hinken in Richtung Klassenraum lief. Sie fragte, ob ich keine Augen im Kopf habe, ob ich nicht gesehen habe, dass sie kommt, und ob ich nicht weiß, dass sie Anfang der Woche einen Herzkatheter bekommen hat, was ich nicht wusste, und trotzdem brach ich in Tränen aus, als ich mich entschuldigte. Bianca sagte „Nicht so schlimm“ auf Hebräisch und fügte hinzu: „Quando si chiude una porta, si apre un portone.“ Den Rest des Unterricht ließ ich die Schüler Paarübungen machen, denn jedes Mal, wenn ich ein Wort sagen wollte, spürte ich, wie das große Weinen wieder in mir aufstieg. Erst nachdem sie mir ganze Theaterstücke vorgespielt hatten – Ärztin und Patient, Verkäuferin und Kunde, Polizistin und Räuber – fühlte ich mich etwas gelöster, applaudierte und korrigierte ihre Fehler mit fester Stimme, doch als ich „Bis Montag“ sagte, stieg das große Weinen wieder in mir auf, und ich konnte nichts dagegen tun. Während ich die Tafel wischte und mir die Tränen abtrocknete, gingen meine Schüler mit gesenktem Kopf aus dem Klassenraum, und nur Bianca kam, um mich zu umarmen, und sagte auf Hebräisch: „Ich weiß, dass ich dir nicht wehtun wollte“, und fügte hinzu, sie hätte einmal etwas darüber geschrieben – ohne zu erklären, was genau sie meinte – und fragte, wie es um mein Deutsch stand. „Wird besser“, sagte ich, und sie umarmte mich wieder, und so kam ich das erste Mal auf den Gedanken, ihre Kritiken zu lesen. Die Kritiken meiner Schülerin Bianca, die ich online fand und abwechselnd auf Deutsch und in KI-Übersetzung las, richteten ihre Spitzen in den letzten Jahren gegen die Krankheit des Narzissmus, die ihrer Meinung nach in der Literatur um sich gegriffen hatte, und all diesen Kritiken lag die Annahme zugrunde, dass zwischen Autorin und Leserin notwendigerweise eine Trennung, eine Hierarchie besteht, wonach die Autorin die Herrin, und die Leserin die Knechtin ist. Wenn Bianca in einem Buch das Wort „Ich“ liest, dann übersetzt sie es – fürchte ich – in ein „Du“. Statt „Es war ein verrückter, schwüler Sommer, dieser Sommer, in dem die Rosenbergs auf den elektrischen Stuhl kamen und ich nicht wußte, was ich in New York eigentlich wollte. Bei dem Gedanken an Hinrichtungen wird mir immer ganz anders” liest sie “Es war ein verrückter, schwüler Sommer, dieser Sommer, in dem die Rosenbergs auf den elektrischen Stuhl kamen und DU nicht wußtest, was DU in New York eigentlich wolltest, Esther. Bei dem Gedanken an Hinrichtungen wird DIR immer ganz anders.” Das war mir sonnenklar, auch wenn ich weder Linguistin noch bekannte Literaturkritikerin war, wohl aber Hebräischlehrerin, und zufällig sogar Biancas Hebräischlehrerin, und ich kannte die Metamorphosen der Verwechslung zwischen „Ich“ und „Du“ nur allzu gut, die sich durch die gesamte Hebräisch-Kursstufe A hindurchzieht, für die auch Bianca noch anfällig war. In der ersten Hebräischstunde, wenn alle ihres erwachsenen Ichs entkleidet worden sind und verwirrt einander und der Lehrerin gegenüberstehen, müssen sie den Dialog „Schalom, wer bist du?“, „Ich bin X, wer bist du?“ durch Nachsprechen lernen und ihn paarweise aufsagen. Die Lehrerin spielt den Dialog mit zwei verschiedenen Stimmen vor, mithilfe von Bildern oder Puppen, und beginnt dann, ihn den offenen Mündern der Schüler einzuflößen. In der ersten Runde, in der einer der Schüler als Freiwilliger mitmacht, muss sie noch die Rolle von Y übernehmen. Nachdem sie also beim „Schalom“ wie eine Idiotin gewinkt und beim „wer“ eine übertriebene pantomimische Geste des Erstaunens gemacht hat, zeigt sie bei „Du“ auf den ausgewählten Schüler. In fünfzig Prozent der Fälle wiederholt der Schüler, wie der Idiot vom Dienst, das Pronomen „Du“, statt es durch „Ich“ zu ersetzen und seinen Namen hinzuzufügen. Er sagt: „Du bist Hans“, statt: „Ich bin Hans.“ Und wie soll man da anfangen, zu diskutieren? „Nein, nein, Hans! Ich bin Danielle, DU BIST Hans.“ „Du bist Hans“, wiederholt er wieder in fünfzig Prozent der Fälle. „Nein, nein, ich – ich – ich – bin Danielle. Und du?“ Während dieses Alptraums, der einmal während des Semesters stattfand, blühte ich auf. Spürte die Qual und blühte auf. Ich liebte es, den Lernstoff in ihre Gehirne zu gießen. Mehr noch, ich liebte es, ihnen ein Loch in den Schädel zu bohren und dann die feine Schicht, die das Hirn überzieht, mit einem Teelöffel aufzubrechen, ja, genau, wie bei einer Crème brûlée, und mit demselben Löffel ein kleines Stückchen Hirn herauszuschaben, um Platz für den neuen Stoff zu schaffen. In diesen Momenten konnte ich schon die Pralinen riechen, die ich am Ende von Stufe A2 bekommen würde; die Stufe, in dem das eigentliche pädagogische Wunder geschieht. Vor Stufe A1 kennen sie kein einziges Wort auf Hebräisch, können keinen einzigen Buchstaben des Alefbets lesen. Nach Stufe A1 können sie ein paar Wörter sagen, die sie in jeder lateinischen oder germanischen Sprache schon nach zwei Stunden gelernt hätten, dazu kommt eine ganze Schriftart, mit der sie nichts anzufangen wissen, außer vielleicht Finnegans Wake von Joyce auf Hebräisch zu lesen und genauso wenig zu verstehen wie alle anderen in jeder anderen Sprache. Ein Großteil der Unterrichtsübungen besteht darin, die Phonetik sinnloser Silbenketten zu entschlüsseln, warum also nicht:
bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonnerronntuonnthunntrovarrhounawnskawntoohoohoordenenthurnuk?
Aber dafür sind sie nicht gekommen. Niemals würden sie zugeben, dass sie frustriert sind, aber die ganze Stufe A1 über sind sie frustriert, und die Lehrerin – ich – halte, wie man so sagt, die Hoffnung, den Glauben für sie aufrecht, dass all das eines Tages etwas nutzen wird; und nach einer zweiwöchigen Pause kommen sie wieder, diesmal für Kursstufe A2, und am Ende von A2 begreifen sie bereits, dass sich tatsächlich ganze Sätze aus diesen Buchstaben formen. Und sie lesen tatsächlich in einer neuen Sprache. Und dann kommen die Pralinen. Und dann kommt die Undankbarkeit. Das Plateau. Sie hören auf, den neuen Wörtern Wichtigkeit beizumessen, die Auswahl erscheint ihnen willkürlich. Immer wollen sie wissen, wie man etwas sagt, das nicht im Lehrplan steht, und bestehen darauf, gerade die Wörter zu vergessen, die im Lehrplan stehen – Wörter, die gezielt, wenn auch nicht immer sorgfältig, ausgewählt wurden. Im Zuge dieses trotzigen Vergessens verflüchtigt sich auch die bereits erreichte Beherrschung der Personalpronomen. Die Plateauphase wird oft zu einer Phase des Rückschritts. Wieder kommt die Schwierigkeit, in einem Dialog zwischen der ersten und der zweiten Person Singular zu wechseln, zwischen Schüler und Lehrerin – die inzwischen weiß, dass sie am Ende dieses Semesters keine Pralinen bekommen wird. Jedes Mal, wenn ein Schüler vergisst, überhaupt ein Personalpronomen einzusetzen, und etwa fragt: „Wo wohnt?“, erinnert ihn die Lehrerin an das fehlende Wort. Und der Schüler wiederholt das Pronomen, wenn er es eigentlich verändern müsste, und verändert es, wenn er es eigentlich nur wiederholen sollte. Beim Üben von Fragewörtern wird die richtige Verwendung der Pronomen schließlich ganz aufgegeben:
– Er wohnt in Jaffa. Was ist die Frage?
– Wo wohnt er?
– Fantastisch. Wir fahren an den See – was ist die Frage?
– Wohin fahren wir?
– Sorry, DU fährst nicht mit an den See. Wir fahren an den See. Was ist die Frage?
Die Lehrerin mag sich damit zufriedengeben, dass der Schüler die Antwort kennt – das heißt, dass er weiß, welches das richtige Fragewort ist – selbst, wenn er den Personalpronomen gegenüber gleichgültig ist; selbst wenn sichtbar wird, dass Pronomen in ihm noch kein Gefühl eines Ichs und eines Dus auslösen, kein Gefühl eines Ichs und eines anwesenden Anderen, kein Gefühl eines Ichs und eines abwesenden Anderen, kein Gefühl von Geschlecht, von Anzahl. Doch Bianca, die bekannte Literaturkritikerin, war nicht so. Sie beherrschte das Hebräische ausgezeichnet – so sehr, dass ich sie manchmal verdächtigte, sie rücke nur deshalb nicht in die nächste Stufe vor, weil sie sich nicht von mir trennen wollte – und niemals hatte sie Schwierigkeiten, in einem Dialog zwischen den Personalpronomen zu wechseln. Viel eher vermutete ich sogar, dass sie diese manchmal unnötigerweise vertauschte, wenn sie Literatur in der ersten Person Singular las. Wie viele andere Kulturkritiker klagte sie in ihren Essays darüber, dass junge Menschen heute glaubten, sie müssten sich in jedem Kunstwerk wiedererkennen. Sie lesen ein Buch und erwarten, dass es ein Spiegel ist, während ein Buch kein Spiegel, sondern eine Tür sein sollte. Als ich Biancas Onlinespuren in zwielichtige Foren und YouTube-Channels verfolgte, fand ich das Video einer jungen kanadischen Autorin, die Bianca zitierte und zum Schluss – auf Deutsch, für welches Publikum war nicht klar – verkündete: „Nie ein Spiegel, immer eine Tür.“ Einen Moment war ich überrascht, denn unter den Büchern dieser jungen kanadischen Autorin befand sich auch eine autobiografische Erzählung über ihre Entscheidung, keine Mutter zu werden, und darüber, wie sie kurz darauf doch Mutter wurde, und viele ihrer Texte waren in der zweiten Person Singular geschrieben. Doch sie hatte auch ein wunderbares, fast dystopisches Buch geschrieben, und es war offensichtlich, dass sie überhaupt eine kundige Leserin dystopischer Literatur war, überhaupt eine Leserin mit breitem Horizont, die sich weder vor ihr fremden Wissensbereichen fürchtete noch vor unbekannten Realitäten oder Fiktionen, und deshalb war klar, dass sie, trotz der autobiografischen Erzählung, die Türen den Spiegeln vorzog. Erst einige Tage später, als ich mich in einer Kabine im Klo der Deutschschule gegenüber der Warschauer Brücke versteckte, weil ich gehört hatte, wie Muhammad zu jemandem “Hey, Adi!” gerufen und dann die Antwort “Hey, du!” erhalten hatte, von einer Stimme, die vermutlich Adi gehörte, begriff ich, dass mir das Wesentliche ihrer Worte entgangen war, da ich mich zu sehr darauf konzentriert hatte, über Arten von Texten nachzudenken, statt über Arten des Lesens. Die kanadische Autorin hatte gar nicht gesagt, sie bevorzuge eine bestimmte Art von Büchern, sondern dass sie sie lieber im Tür-Modus als im Spiegel-Modus liest. Das heißt: Egal, ob wir über das lesen, was uns am fernsten ist, oder über unseren Zwillingsbruder – der uns ja selbst das Fernste sein kann –, wir sollten das Andere suchen, das Unbekannte, nicht das, was uns spiegelt. Meine Schülerin Bianca hatte wohl von allen Dächern ihr Tür-Dasein hinausschreien wollen, als Gegenreaktion auf das weitverbreitete Spiegel-Dasein, doch sie hatte zu beweisen versucht, dass in der Literatur selbst ein übermäßiger Narzissmus um sich greift, anstatt zu argumentieren, dass er sich in der Umgebung der Literatur, in ihrer Peripherie, in ihren Lesern und Leserinnen ausbreitet. Und das war der Beweis dafür, dass der Tür-Zustand etwas zu hölzern sein kann, so hölzern, wie er klingt, und so eine Häufung von Unfällen des Typs „Ich bin gegen die Tür gelaufen“ einlädt, die, wie man weiß, immer erstunken und erlogen sind und nie die ganze Wahrheit erzählen. Es ist immer etwas anderes passiert. Ist es überhaupt sinnvoll, fragte ich mich beim Schwänzen, in der S-Bahn, in der U-Bahn, in unserer dunklen Wohnung in Neukölln, beim Versuch, ohne Genickbruch den Himmel zu sehen, einen intimen Text in der ersten Person als rein anthropologischen Bericht zu lesen?, und legte die Frage nach dem literarischen Stil beiseite, denn auch wenn Bianca poetische Qualitäten zu schätzen wusste, schnitt sie stets geradewegs durch sie hindurch zum Inhalt. Und wenn dieser Inhalt von jener Krankheit befallen war, die ihrer Meinung nach in der Literatur um sich greift, erlag sie der Versuchung und ersetzte jedes „Ich“ durch ein „Du“, als wäre es unmöglich, dass derjenige, der immer und immer wieder „Ich“ sagt, auch etwas sagen könnte, das auf sie zutrifft; er also von Anfang an gar nicht von sich selbst sprach, sondern von ihr; doch sie konnte das nicht sehen, weil sie dem Tür-Dasein so verpflichtet und dem Spiegel-Dasein so abgeneigt war. Ich fragte mich, ob wir, wenn wir einen Text in der ersten Person lesen, nicht eigentlich alle Personalpronomen gleichzeitig ineinander überführen sollten, ganz so, als wären wir sehr geduldige Schüler in der Plateauphase beim Lernen einer neuen Sprache.
- Unter Premierminister Ariel Sharon führte Israel 2005 den einseitigen „Gaza-Rückzug“ (Hitnatkut) durch. Etwa 8.000 Siedler:innen wurden aus 21 Siedlungen im Gazastreifen und vier im nördlichen Westjordanland evakuiert; die israelische Armee zog dauerhaft aus Gaza ab und räumte ihre Stützpunkte. [↩]
- Neturei Karta – Eine kleine, ultraorthodoxe jüdische Gruppe, die den Zionismus aus theologischen Gründen ablehnt und die Errichtung eines jüdischen Staates vor dem Kommen des Messias als Verstoß gegen den göttlichen Willen betrachtet. Obwohl die Mitglieder die Existenz Israels ablehnen, grenzt sie ihr strenger religiöser Fundamentalismus und ihre Zurückweisung der säkularen Moderne deutlich von linken oder säkularen Formen des Antizionismus ab. [↩]