Diese Welt ist nicht meine Heimat
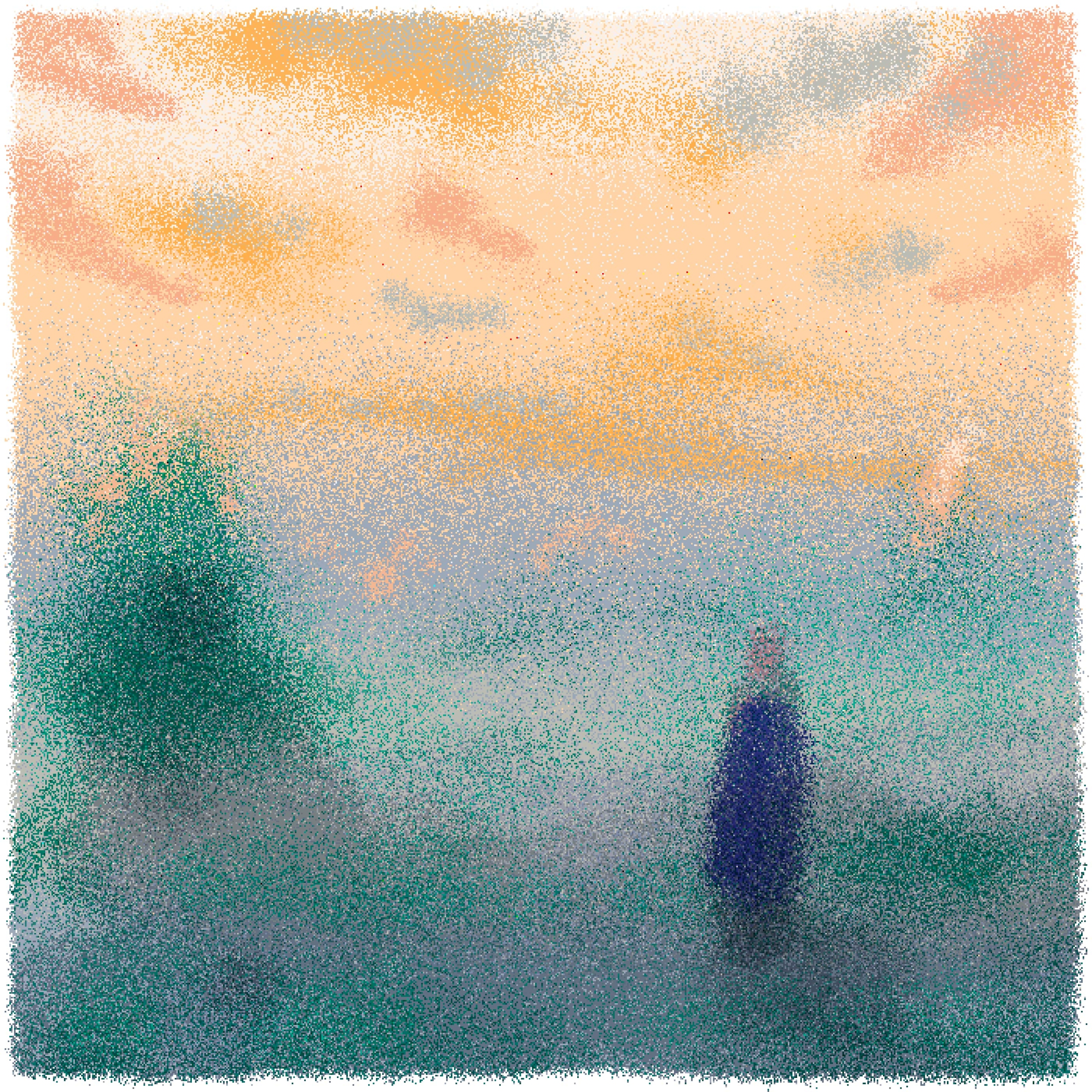
Es gibt ein kleines Tier in mir, das ein Biotop haben will. Ein Territorium, zu dem es gehört und das ihm gehört. Es will nicht unbedingt dort bleiben. Es will aus seinem Bau hervorkriechen, seine Eltern verlassen und in die große Welt hinausziehen, aber trotzdem irgendwo hingehören und von den anderen, die aus dem gleichen Biotop stammen, erkannt werden als eines der ihren. Auch wenn es sie nicht alle mag und sie es nicht alle mögen. Es will eine Antwort auf die Frage haben: Wo kommst du her?
Eine Antwort auf diese Frage habe ich nicht, weil Gott in den 70er-Jahren einem jungen Paar mit Wohnsitz in Dallas, Texas den Auftrag gegeben hat, als Missionare nach Europa zu gehen, zu den Ostdeutschen hinter dem Eisernen Vorhang. Sie, auf einem Bauernhof in Ohio aufgewachsen, war schüchtern und schrieb Gedichte, er kam aus Kalifornien, war schneidig und sonnenblond, und obwohl sie nie im Ausland gewesen waren und keine Fremdsprache konnten, nahmen sie den Auftrag an und verließen wenige Jahre nach ihrer Heirat alles, was sie hatten und kannten. Ihr Biotop. Nur ihr sechs Monate altes Baby nahmen sie mit, mich.
Unsere erste Station war Brighton, England, wo ich krabbeln und laufen lernte und meine Eltern auf das Missionsfeld vorbereitet wurden. Wir würden im Westen leben, mein Vater würde alle paar Monate als Tourist in die DDR einreisen, evangelikale Pamphlete und seine Notizen für Predigten, in Geheimfächern im Auto und im Thermoskannengehäuse versteckt, ins Land schmuggeln, meine Mutter würde zuhause bleiben mit mir und den weiteren Kindern, die noch kommen sollten, und keine Gedichte mehr schreiben.
Nach einem Jahr in Sussex sind wir nach St. Andrä-Wördern gezogen, einer Kleinstadt vor Wien, wo ich sprechen lernte, die Muttersprache meiner Eltern, meine Eltern beim Goethe-Institut mühsam Deutsch, mein Vater machte erste Undercover-Reise in die DDR. Ich bekam in St. Andrä-Wördern ein Zuhause, ein Einfamilienhaus mit einem endlosen Garten, über den ich auf der Schaukel hinwegflog, mit einem blau-weißen Bad mit zwei Waschbecken, wo mein Bruder und ich zähneputzend nebeneinander auf kleinen Schemeln standen und uns gegenseitig auf den Kopf spuckten. In der mit dunkler Holzvertäfelung ausgekleideten Küche gab es eine Eckbank, dieses deutsche Wort behielten wir in unseren englischen Gesprächen bei, wir sagten auch Windfang und Kachelofen und Semmel, aber ansonsten spielten, sangen, beteten und stritten wir in unserer Muttersprache. Auf den Kindergarten bereiteten mich meine Eltern vor als einen Ort, wo ich mit anderen Kindern Deutsch lernen würde. Der Schock, dass dort alle Kinder schon am ersten Tag Deutsch konnten, und zwar richtig gut, ließ mich verstummen. Erst Monate später machte ich den Mund wieder auf, als schon vollständige deutsche Sätze herauskamen, vermutlich mit niederösterreichischer Färbung. Als wir wenige Monate vor meinem fünften Geburtstag wieder umgezogen sind, ging diese aber für immer verschütt. Gott hatte wieder gerufen: Zwischen den Missionsreisen in die DDR sollte sich mein Vater auch um die Studierenden in Freiburg im Breisgau kümmern. Büchertische an der Uni, Bibelkreise, Gesangsabende. Meine Eltern erhörten den Ruf, brachen erneut die Zelte ab, packten meinen zweijährigen Bruder und mich und unser Hab und Gut ins Auto und machten sich auf nach Deutschland.
Ich erinnere mich noch gut an diese Reise. Wie ich dort auf der Rückbank im Renault-Kombi, neben mir mein Bruder im Styropor-Kindersitz arglos vor sich hin strampelnd, den Verlust dunkel in der Magengrube spürte. In der Früh waren wir noch zuhause aufgewacht. Dann waren wir fortgefahren – und würden nicht zurückkehren. Das Haus, der Garten, sie waren ohne uns zurückgeblieben. Unbegreiflicherweise standen sie jetzt wohl noch dort.
Meine Eltern beschäftigte auf der Autofahrt etwas anderes. Als wir uns unserem Ziel in Freiburg näherten, kommentierten sie die Szenerie, zeigten sich Dinge, die ihnen im Stadtbild auffielen. Ich wollte mitreden und rief dazwischen: Reminds me of Austria! Meine Eltern lachten ein nachsichtiges Erwachsenenlachen. No honey, sagte mein Vater. This is is a different country. Aus dem Fenster sah ich nichts Exotisches: Straßen, Bäume, Wohnhäuser, Stadt. Geparkte Autos, Fußgängerinnen, Fahrradfahrer, Sonne. Was sahen meine Eltern da draußen, das sie dieses andere Land erkennen ließ? Was ist der Unterschied zwischen einem Land und einem anderen? Eine Weile kaute ich an dem Rätsel, dann ließ ich es los.
Was sahen meine Eltern da draußen, das sie dieses andere Land erkennen ließ? Was ist der Unterschied zwischen einem Land und einem anderen?
An diesem ersten Abend aßen wir in der leeren, von einer nackten Glühbirne grell beleuchteten Küche in der neuen Wohnung. Trotz ihrer zugigen Unmöbliertheit war sie seltsam beengend, die Wohnungstür ging nicht ins Freie, sondern in ein hallendes Treppenhaus, dessen Status mich ratlos machte: Gehörten die mit beigem Laminat bezogenen Treppen zu diesem neuen angeblichen Zuhause oder schon zum Draußen? Ab und zu hörte ich dort Fußtritte, fremde Menschen liefen dicht an uns vorbei während wir am provisorisch eingerichteten Küchentisch zu Abend aßen, umgeben von gestapelten Umzugskartons. Ich fühlte mich entblößt. Meine Mutter, im sechsten Monat schwanger, war bis zur Unzurechnungsfähigkeit erschöpft, mein Vater flackerig, sprang ständig auf, um irgend etwas suchen zu gehen. Vor mir auf dem Teller lag ein grässliches Pumpernickelbrot aus der Packung. Noch nie hatte sich etwas derart Schreckliches hinter dem Wort Brot verborgen. Ich würgte es mit Entsetzen hinunter und dann wusste ich’s: Das hier ist nicht nur einfach nicht Zuhause. Das hier ist ein anderes Land. Ich bekam eine Ahnung davon, was meine Eltern im Auto gemeint haben könnten. In Österreich gab es so etwas nicht. Diese garstige, schwarze Masse, die zwischen meinen Zähnen ohne Widerstand nachgab und dort kleben blieb, das war wohl dieses Deutschland. Jetzt kaute ich an des Rätsels Lösung, zutiefst enttäuscht.
In diesem Deutschland blieben wir zehn Jahre. Sie waren weltgesättigter als die Kleinkindjahre in Österreich, welche ich genauso gut in Dubai hätte verbringen können (mit den gleichen Eltern) ohne sonderlich anders zu werden, als ich es geworden bin. In Freiburg dagegen wurde ich ein bisschen deutsch – und wohl ein bisschen freiburgerisch, wenn ich mich auch nie mit dem Pumpernickelbrot angefreundet habe: Ich habe eine überdimensionierte Schultüte gehabt und auf Kindergeburtstagen topfgeschlagen, Blockflöte, Pelikanfüller, Laterne Laterne, Bravo, Adventskalender. Ich hatte in der Grundschule eine Neslihan in der Klasse, die mit ihrer Familie in den Gastarbeiterbaracken am Messplatz wohnte und die, anders als ich, von den Lehrerinnen und Mitschülern als Ausländerin herausgestellt wurde; ich habe den von Kriegshass und Verbitterung zerfressenen Nachbarn gekannt, zu dem wir nett sein sollten, weil er so viel Schlimmes erlebt habe (was er eventuell gemacht hat, kam nicht zu Wort); ich sah die Graffitis an den Wänden, die die Amis aufforderten, nach Hause zu gehen, und fühlte mich angesprochen, das Anarchistensymbol (ich dachte, es stand für Arschloch), und 1984 ist jetzt. Mein Vater machte sich zwar lustig über das Schild an der Hauseinfahrt, das unberechtigt geparkten Autos mit kostenpflichtiger Abschleppung drohte und über den Konjunktiv I in den Radionachrichten, aber im Großen und Ganzen vertrugen sich meine Eltern sehr gut mit dem Deutschen, mit dem Badischen. Sie gingen mit uns wandern, sie liebten die Sperrmüllwochen und das Abendbrot und die ordentliche Sauberkeit – zum Glück hat uns Gott nicht nach Frankreich berufen, sagten sie oft, in Frankreich ist es schmutzig. Manchmal waren sie deutscher, oder was sie dafür hielten, als die Deutschen: Meine Mutter schickte mich im Dirndl in die Schule, alle anderen Freiburger Gören der frühen 80er-Jahre trugen Cordhosen und Schlabberpullis.
Manchmal waren sie deutscher, oder was sie dafür hielten, als die Deutschen: Meine Mutter schickte mich im Dirndl in die Schule, alle anderen Freiburger Gören der frühen 80er-Jahre trugen Cordhosen und Schlabberpulis.
Dennoch – und deswegen – klebt Freiburg nicht tief genug in meinen Poren, als dass ich behaupten könnte, die Stadt wäre mein Biotop. Ich bin nicht aus ihr gemacht, wie meine Mutter aus Ohio gemacht ist oder mein Vater aus Kalifornien. Wenn ich heute in Berlin, wo ich seit über zwanzig Jahren lebe, Menschen treffe, die auch in Freiburg aufgewachsen sind, zögere ich, mich als Landsmännin vorzustellen. Meine Eltern waren und blieben dort Fremde, mit ihren Wurzeln auf der anderen Seite des Atlantiks, ihrem amerikanischen Akzent, ihrem gottgegebenen Auftrag, der ihren Wohnort zum Missionsfeld machte, zu einem Acker, den sie zu bestellen hatten, anstatt zu einem Raum, der sie aufnehmen und prägen durfte. Ich und meine Geschwister waren zwar weniger fremd, die kulturellen Praktiken der Schule, der Nachbarschaft, der Medien (damals nicht das globale Internet, sondern Lokalsender, deutsches Fernsehen und die Stadtbibliothek) hinterließen ihre Spuren in uns und als weiße Kinder galten wir derart als „Deutsch passing“, dass ich als Grundschülerin meinen Pass in die Schule brachte, um zu beweisen, dass ich wirklich Amerikanerin war und nicht bloß Angeberin. (Solche Probleme hätte Neslihan bestimmt gerne gehabt.) Aber wir verloren unseren Status als Freiburger:innen in dem Moment, als wir von dort wegzogen. Denn wir ließen nichts zurück, das uns hätte an den Ort binden können, keine Oma oder Tante, kein Grundstück, das wir einmal erben würden, keine Familienerzählungen, die uns an dieses Fleckchen Erde vertäuten, weil seine Geschichte auch die unsere war. Wir hatten nichts mit dieser Geschichte zu tun.
Es hätte also genauso gut wieder ein anderes Land sein können, wohin wir dieses Mal zogen, auch wenn es tatsächlich nur knapp sechzig Kilometer in den Süden war, ins Kandertal. Ich war 14. Unsere Eltern hatten uns dort an einer englischsprachigen, erzkonservativen christlichen Privatschule angemeldet. Meine mittlerweile vier Geschwister und ich wären dort in dieser Missionars-Bubble, noch dazu auf dem Dorf, besser aufgehoben als an öffentlichen Schulen in der linken Unistadt, waren sie überzeugt. Meine Freundinnen weinten beim Abschied so herzzerreißend, als würden sie mich nie wiedersehen. Und das taten sie auch nicht: Als ich ein paar Jahre später zum Besuch auftauchte, erkannten sie mich nicht wieder hinter meiner dicken Schminke und meinen Auslassungen über Schwule, die in die Hölle kommen würden.
Missionars-Bubble hieß außer dieser Art von Gehirnwäsche, dass wir in Kandern nicht im Schwarzwald und nicht in Deutschland lebten, sondern in der Parallelgesellschaft der Black Forest Academy, wo meine Klassenkameradinnen, deren Eltern über die ganze Welt als Missionare verstreut waren, auch nicht wussten, wo sie hingehörten oder herkamen. Die Schule verbot es uns, mit der Dorfjugend abzuhängen. Mein Deutsch verrostete. Meine Welt schrumpfte wieder zu der Privatsphäre zusammen, die sie damals in St. Andrä-Wördern gewesen war: Die Schule war so etwas wie eine erweiterte Familie, und außerhalb der Schule gab es nichts. Damit fühlten sich meine Eltern wohl, denn in dieser Großfamilie gäbe es keine gefährlichen Einflüsse, keine Versuchung, vom wahren Weg abzukommen. In der Welt sollten wir uns ohnehin nicht heimisch fühlen. Denn diese Welt ist nicht unsere Heimat; wir erwarten unsere zukünftige Stadt erst im Himmel, heißt es im Hebräerbrief, und deswegen war es auch in ihren Augen unbedenklich, die Zelte immer wieder abzubrechen. Die Konstante war der Glaube und war die Familie, und das sollte reichen, um uns zu erden. Oder zu himmeln.
In der Welt sollten wir uns ohnehin nicht heimisch fühlen. Denn diese Welt ist nicht unsere Heimat; wir erwarten unsere zukünftige Stadt erst im Himmel, heißt es im Hebräerbrief, und deswegen war es auch in ihren Augen unbedenklich, die Zelte immer wieder abzubrechen.
Gleichzeitig ahnten meine Eltern, dass wir auch einen irdischen Ort brauchten, ein räumlich-sozial-kulturell beschaffenes Territorium, wo wir uns zugehörig fühlen könnten. Vielleicht wegen ihres eigenen Heimwehs nach Amerika, das sie immer wieder überkam, trotz der Aussicht auf die zukünftige Stadt. Also veranstalteten sie Heimatabende für uns, an denen wir Johnny Cash hörten und Burger aßen und unser Vater sagte: Das ist Amerika, Kinder! Da kommt ihr her! Wir feierten mit Wunderkerzen und rot-weiß-blauen Luftballons den 4. Juli und meine Mutter backte im Februar zum Anlass von George Washingtons Geburtstag einen cherry pie, wie es Hausfrauen in ihrer Kindheit getan hatten. Dass das in den 90er-Jahren wohl kaum jemand mehr tat, wusste sie nicht, sie war schon Jahrzehnte lang fort gewesen und war in der Hinsicht amerikanischer als die Amerikanerinnen. So konservierten sich meine Eltern ihre irdische Heimat und boten sie uns an, eingeschweißt in aus dem Kontext gerissenen Ritualen. Dass wir nach der Schule in die USA „zurückkehren‟ würden, war selbstverständlich.
Der Versuch, künstlich Zugehörigkeit zu einem Ort in der Ferne herzustellen schlug gründlich fehl. Als wir als junge Erwachsene zum Studium nach Amerika zogen, war es für mich und meine Geschwister trotz der Bemühungen meiner Eltern keine Heimkehr für uns, sondern eine Umsiedelung in ein anderes Land, das uns fremd war, uns auch abstoß. Ohne dass wir uns deswegen im Umkehrschluss deutsch fühlten. Als wir dann auch noch, eine nach dem anderen, den Glauben unserer Eltern ablehnten, war die Heimatlosigkeit komplett.
Ein Kind schläft. Sein eigenes Leben spult sich unter seiner Haut und in seinem Schädel ab, erst wenn es die Kindheit ablegt, ein Jahrzehnt nach dem anderen, kann es den wirklichen historischen Fluss wahrnehmen, den Schauplatz seines eigenen träumenden Lebens – die Nation, die Stadt, die Nachbarschaft, das Haus, wo die Familie wohnt – als ein wirkliches, unfertiges Projekt, ein Projekt, das lebende Menschen gewollt und gut vorangebracht haben oder woran sie gescheitert sind und an dem sie und auch es, das Kind, noch arbeiten, schreibt Annie Dillard in ihren Memoiren1. Das deutsche Wort Heimat leitet sich vom indogermanischen kei ab, das „liegen“ bedeutet. Die Heimat ist der Ort, in dem wir als Kinder hineingelegt werden, das Setting, das gegeben ist und das wir noch nicht erfassen können. Und es ist eben diese Ahnungslosigkeit, mit der wir als Kinder vor uns hinleben, die es diesem Setting möglich macht, uns unwiederbringlich zu prägen. Ich war in dem Moment, in dem ich an den einzigen Ort angekommen bin, der in meiner Kindheit so etwas wie eine Heimat hätte werden können – Freiburg – aber nicht mehr nur mit meinem eigenen wolkigen Innenleben, meinem Körper, mit den Spiel-, Lust- und Angstdingen meiner unmittelbaren Umgebung beschäftigt, sondern schon in einer Welt der kulturellen Unterschiede aufgewacht. Freiburg bin ich zusammen mit meinen Eltern mit vergleichenden Touristenaugen begegnet. Das Pumpernickelbrot war nicht nur eklig, es war deutsch, das wusste ich schon mit vier, und war damit von Anfang an auf Distanz. Nie war ich dort auf jene Art unbewusst, die die Voraussetzung dafür ist, durchdrungen und gemacht zu werden von einem Ort. Ich bin nicht irgendwann aufgewacht in Freiburg, in Deutschland, im von Eltern und Großeltern vorgewärmten Bett, und habe festgestellt, aha, das ist meine Heimat, wie langweilig oder wie schön oder bloß weg hier.
Aufgewacht bin ich stattdessen im Evangelikalismus US-amerikanischer Prägung. Bloß weg hier. Abgelehnt habe ich diesen Glauben und sein ganzes kulturelles Zubehör als junge Erwachsene. Der Prozess, ihn aus meinem Denken und meinem Körper auszumerzen, wird mich wohl noch bis an mein Lebensende begleiten. Wenn ich eine Heimat habe, dann diese Religion, der ich bewusst und aktiv den Rücken zugekehrt habe und kehre. Aber als Antwort auf die Frage: Wo kommst du her? taugt „aus dem Christentum‟ kaum, da fehlt die Räumlichkeit, das Psychogeographische, die Alltagshäuslichkeit des Baus, wonach das Tier in mir sich so sehnt. Es wünscht sich, von einem Ort so fest umarmt zu werden, wie meine verwurzelteren Freunde und Freundinnen, meine Eltern, von ihren Herkunftsorten umarmt werden. Meine Eltern leben mittlerweile wieder in Ohio und freuen sich im hohen Alter mit unerschütterlicher Zuversicht auf ihre wahre Heimat im Himmel.
- Annie Dillard, An American Childhood. New York: Harper & Row, 1987, p. 74 ↩︎