Die bitteren Tränen des Klaus Biesenbach
Übersetzt von der Redaktion
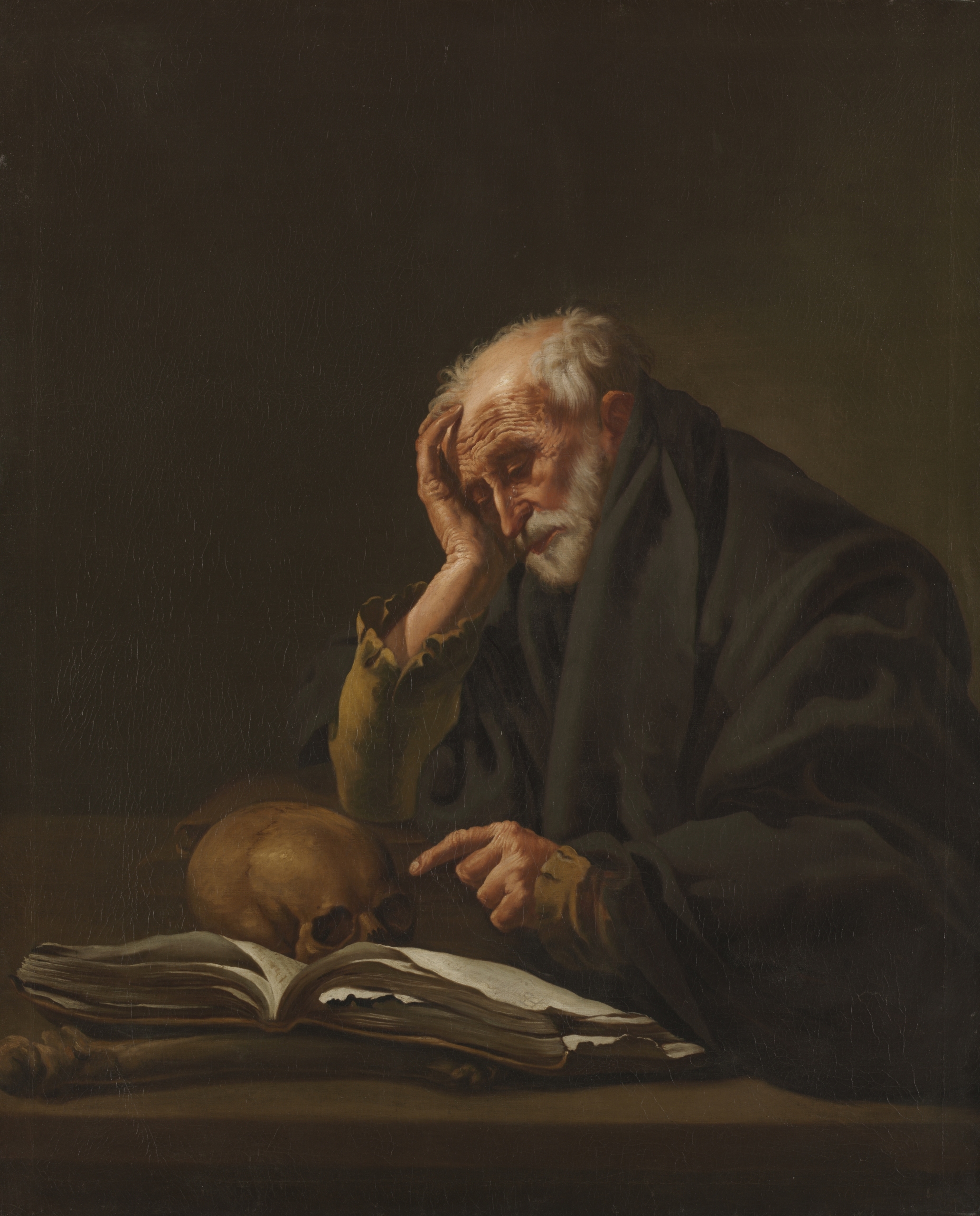
EINE RUNDE MITLEID MIT KLAUS BIESENBACH BITTE, dem Direktor der Neuen Nationalgalerie. Wie er diesen Sommer gegenüber dem Spiegel erklärte, fiel es ihm „schwer zu ertragen“, dass die jüdische Fotografin Nan Goldin bei der Eröffnung ihrer Ausstellung im vergangenen Dezember eine Rede hielt, in der sie Israels anhaltenden Völkermord an der Bevölkerung Gazas kritisierte. Mehrere Monate nach Goldins Intervention scheint Biesenbach die meiste Zeit damit verbracht zu haben, über sich selbst nachzudenken und nur wenig darüber, was er hätte anders machen können. „Ich war extrem herausgefordert von der Situation“, sagte er. „Weil ich gleichzeitig in verschiedenen Identitäten agieren musste. Einerseits als Vertreter einer Institution, der deutschen Nationalgalerie. Gleichzeitig aber auch als ein Mensch, der mit 19 Jahren in einen Kibbuz gezogen ist und inzwischen auch eine andere Staatsangehörigkeit angenommen hat, weil ich es wegen der Naziverbrechen nicht ausgehalten habe, nur deutsch zu sein.“
Biesenbach war nicht der einzige Deutsche, dem Goldins Rede schwerfiel. Hermann Parzinger, ehemaliger Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, schloss sich der Kritik an. Goldins Rede fand er angeblich „unerträglich“, folglich auch dieses Zitat von ihr: „Meine Großeltern sind vor den Pogromen in Russland geflohen. Ich bin mit dem Wissen um den Holocaust der Nazis aufgewachsen. Was ich in Gaza sehe, erinnert mich an die Pogrome, denen meine Großeltern entkommen sind. Nie wieder bedeutet nie wieder für alle.“
Das sind alles herausfordernde und schwierige Fragen, insbesondere wenn sie an eine kulturelle Elite gerichtet sind, die mit dem Rückgrat einer Qualle alle möglichen humanitären und internationalistischen Prinzipien über Bord geworfen hat.
Unerträglich herausfordernd zu sein, darum ging es Goldin. „Fühlen Sie sich unwohl?“, fragte sie. „Ich hoffe es. Wir müssen uns unwohl fühlen.“ Dann richtete sie ein paar Fragen an Deutschland: „Habt ihr Angst? Was habt ihr gelernt? Warum könnt ihr nicht hören? Warum könnt ihr nicht sehen?“ Das sind alles herausfordernde und schwierige Fragen, insbesondere wenn sie an eine kulturelle Elite gerichtet sind, die mit dem Rückgrat einer Qualle alle möglichen humanitären und internationalistischen Prinzipien über Bord geworfen hat, um sich munter an einer aggressiv nationalistischen, fremdenfeindlichen Unterdrückung zu beteiligen.
Die vergangenen Monate haben deutlich gemacht, dass gerade diejenigen, die am dringendsten über Goldins Worte nachdenken sollten, sich stattdessen dazu entschlossen haben, ihre egozentrische Ignoranz weiter zu verstärken. Viele von uns, die glauben, dass gerade wegen des Holocaust ethnische Säuberungen und Völkermord nie wieder geschehen dürfen, also diejenigen von uns, für die „nie wieder“ eben nicht mit einem Sternchen versehen ist oder erst mit einer Hautfarb-Tabelle überprüft werden muss, argumentieren oft, dass die anti-palästinensische Unterdrückung durch Deutschland nicht nur ein Akt des Reputationsmanagements ist, sondern einem neuen, stärkeren Nationalismus Vorschub leistet. Die Staatsräson bietet die unwiderstehliche Versuchung, die eigene Schuld in Selbstgerechtigkeit umzuwandeln. Entsetzen und Selbsthass werden in Stolz und Patriotismus umgewandelt, wenn der Holocaust zur Ursprungsgeschichte dafür wird, weshalb die Deutschen beim Antisemitismus einfach besser Bescheid wissen.
Ja, die Deutschen wissen alles besser: besser als rassifizierte Menschen, das versteht sich von selbst, und natürlich besser als Jüdinnen und Juden, die so oft unbequem sind.
Ja, die Deutschen wissen alles besser: besser als rassifizierte Menschen, das versteht sich von selbst, und natürlich besser als Jüdinnen und Juden, die so oft unbequem sind, wenn wir uns als echte Menschen mit eigener Handlungs- und Urteilsfähigkeit erweisen, in der Lage, selbst zu sprechen, statt nur abstrakte Vertreter des beliebten deutschen Klischees zu sein, das „jüdische Leben” zu schützen. Es ist so viel leichter, „in einen Kibbuz zu ziehen und eine andere Nationalität anzunehmen, weil ich es nicht ertragen konnte, nur deutsch zu sein”, statt darüber nachzudenken, was die eigenen Vorfahren an wem getan haben. Ein Kollege sagte mir einmal mit ernster Miene, dass er die Jerusalem-Erklärung zum Antisemitismus, die zwischen Antisemitismus und Antizionismus unterscheidet, nicht akzeptieren könne, weil seine eigenen Überzeugungen zum Antisemitismus in einer „Familiengeschichte verwurzelt sind, die bis zur Arbeit in den Lagern zurückreicht“. Er weinte, als ich Einwände erhob. In solchen Situationen denke ich oft an Hitlers Plan, das Prager Ghetto in ein Museum für die untergegangene jüdische Kultur umzuwandeln, und daran, wie viel wohler sich viele meiner deutschen Gesprächspartner:innen fühlen würden, wenn diese Vision Wirklichkeit geworden wäre.
Bemerkenswert ist, dass Biesenbach sich trotz seiner schweißtreibenden Bemühungen, die Grenzen des Sagbaren durchzusetzen, offenbar als Verfechter der Meinungsfreiheit versteht. Später im Interview kehrt er, offenbar ganz ohne Ironie, zu dem Adjektiv „unerträglich“ zurück, um „diesen neuen Dogmatismus, die Wortdiktate, diese politische Korrektheit und das ‚Virtue Signaling‘“ in der Auseinandersetzung mit Rassismus in der Kunstwelt nach den George-Floyd-Protesten zu beschreiben. Er beschreibt, wie die Gastgeberin eines Kunstdinners einen Löffel fallen ließ, um das Thema zu wechseln, als er das Thema Meinungsfreiheit ansprach. „So groß war die Furcht in der Runde, sich zu äußern und das Falsche zu sagen.“ Können Sie sich das vorstellen? Stellen Sie sich eine Angst vor, die so groß ist, dass ein Museum sich gezwungen gesehen hat, seinen Direktor mit einer vorbereiteten Rede auf die Bühne zu schicken, um einer seiner Künstlerinnen bei ihrer eigenen Vernissage zu widersprechen. Stellen Sie sich eine Angst vor, die so groß ist, dass sie der polizeilichen Durchsetzung bedarf.
Es gibt in der Tat eine Krise der freien Meinungsäußerung in der deutschen Kunstwelt. Dass jemand von Goldins Rang eine Rede bei der Eröffnung ihrer weltweit tourenden Ausstellung hielt – und dann pflichtbewusst zuerst auf der Bühne geschickt und dann am nächsten Tag in den Zeitungen vom Museumsdirektor, der sie eingeladen hatte, angeprangert wurde – ist kaum ein positives Beispiel für kulturelle oder künstlerische Freiheit.
Es muss in der Tat unerträglich sein, wenn man in eigennützigen Verstrickungen gefangen ist und mit der Art von echter ethischer und politischer Klarheit konfrontiert wird, die Goldin demonstriert hat.
Für jemanden wie Biesenbach, der sowohl der Staatsräson dienen als auch für ein globales Kunstpublikum erkennbar progressiv sein muss, besteht hier ein echter Konflikt. Den größten Teil seiner Karriere verbrachte er außerhalb Deutschlands, jetzt ist er zurückgekehrt. Es muss in der Tat unerträglich sein, wenn man in eigennützigen Verstrickungen gefangen ist und mit der Art von echter ethischer und politischer Klarheit konfrontiert wird, die Goldin demonstriert hat. Und wer weiß, unter welchem Druck Biesenbach selbst zu diesem Zeitpunkt stand? Für viel weniger wurden schon Ausstellungen und Menschen entlassen.
E. M. Forster sagte einmal: „Wenn ich zwischen dem Verrat an meinem Land und dem Verrat an meinen Freunden wählen müsste, dann hätte ich hoffentlich den Mut, mein Land zu verraten.” Biesenbach traf eine andere Entscheidung. „Merkwürdigerweise“, sagte er dem Spiegel, „hat mich der Horrorabend der Goldin-Eröffnung in vielem mit Deutschland versöhnt.“ Hier ist es: die Verwandlung von Schuld in Nationalgefühl, von der Scham, überhaupt Deutscher zu sein, zur Versöhnung mit Deutschland. Die dringliche politische Stellungnahme einer jüdischen Künstlerin gegen Völkermord wird zu einem negativen Beispiel, durch das Biesenbach Heilung finden kann. Nachdem er sich von seiner Verbundenheit mit einer ausländischen, jüdischen Künstlerin gelöst hat, nachdem er deutlich gemacht hat, dass er die Prinzipien seiner ehemaligen Freundin Nan Goldin „unerträglich“ findet, kann er seinen Platz als ordentlicher Deutscher einnehmen, der ein ordentliches deutsches Museum leitet.
Sechs Monate nach Goldins Eröffnung, Ende Juli, veranstaltete die Neue Nationalgalerie eine Pride-Viewing-Party. Nur dreißig Gehminuten entfernt wurde der internationalistische Pride-Marsch der Stadt von Polizisten in Kampfmontur brutal aufgelöst. Mit wenigen Ausnahmen wurden weder der anhaltende Völkermord noch das harte Vorgehen gegen die Menschen, die dagegen protestieren, von den staatlich finanzierten Institutionen der Stadt thematisiert. Am 14. September hatten Biesenbach und die Neue Nationalgalerie tausend Berliner eingeladen, im Rahmen der Abschlussveranstaltung einer Yoko-Ono-Ausstellung „Glocken für den Frieden” zu läuten. Das fand ich wiederum schwer zu ertragen.


