Das Autokratenhandbuch
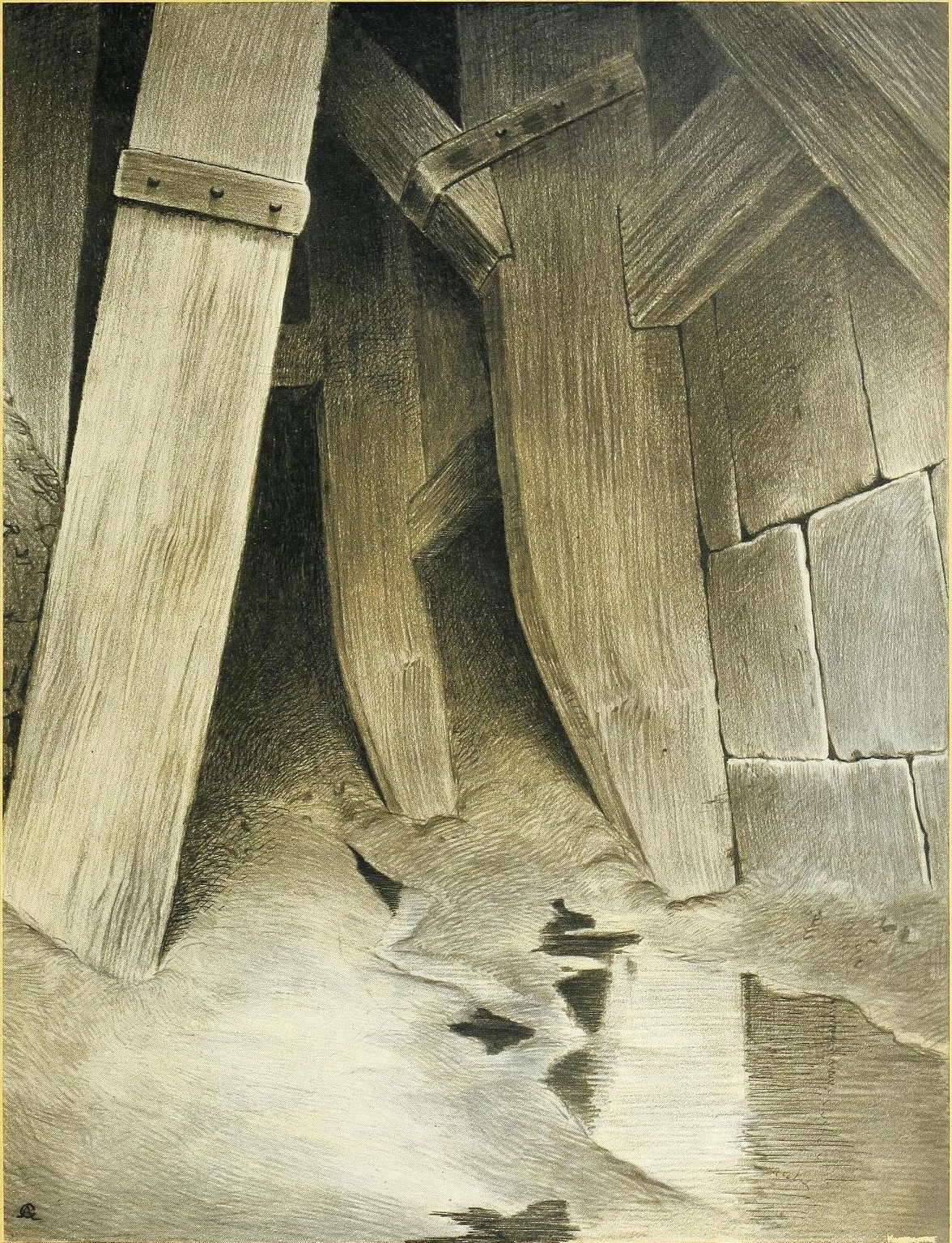
Am 15. Mai verübte ein 71-jähriger, wenig bekannter Dichter einen Anschlag auf den slowakischen Premierminister Robert Fico. Dem kleinen Land im Osten der EU stockte der Atem. Wie konnte es so weit kommen? Dem Attentat vorausgegangen war ein halbes Jahr starker gesellschaftlicher Spannungen, nachdem der Premier seine mittlerweile vierte Amtszeit am 25. Oktober 2023 angetreten hatte. Seitdem treibt er mit einem Regierungsbündnis aus zwei populistischen und einer rechten Partei Schritt für Schritt den Demokratieabbau im Land voran. Damit reiht sich die Slowakei ins Lager jener Staaten ein, in denen der nationalistische Autoritarismus im 21. Jahrhundert Erfolge verzeichnet: Polen unter der PiS-Regierung, Trumps USA der Vergangenheit und Zukunft, Ungarn, Georgien, UK im Brexit-Rausch und Italien unter Melonis „Fratelli D’Italia“.
Internationaler Autoritarismus
Die autoritären Parteien dieser sehr verschiedenen Länder vereint, dass sie sich klar gegen den Pluralismus positionieren und auf die Komplexität der heutigen Welt vermeintlich leichte Antworten bieten. Und sie verfolgen ihre Ziele mit ähnlichen Instrumenten, verwenden oft dieselben Narrative. Anne Applebaum analysiert diese Strategien detailliert in ihrem Buch „Die Verlockung des Autoritären“ (2020): „Unter den passenden Bedingungen kann sich jede Gesellschaft von der Demokratie abwenden,“ bemerkt sie darin. Auch in Österreich (wo wahrscheinlich demnächst die rechtsextreme FPÖ mit Kickl den Kanzler stellen wird), Frankreich und Deutschland ist der Autoritarismus auf dem Vormarsch. Wie die Wende vom Demokratischen zum Autoritären funktioniert, lässt sich in der Slowakei gerade „live“ mitverfolgen.
Stimmungsmache gegen Andersdenkende
Obwohl Ficos Partei Smer sich selbst als sozialdemokratisch sieht, ist sie das mitnichten – sie steht vielmehr für nationalkonservative Positionen und das Verunglimpfen Andersdenkender. Im Wahlkampf veröffentlichte Smer einen kurzen Clip, der buchstäblich unter die Gürtellinie ging: Er zeigt, wie ein dem liberalen Politiker Michal Šimečka ähnlich sehender Mann, der in eine Regenbogenflagge gehüllt ist, sich nicht entscheiden kann, welche Toilette er betreten soll, während im Hintergrund die Schul-Pausenglocke läutet. Fico läuft ins Bild und sagt lächelnd in die Kamera: „Während der progressive Misho sich entscheidet, ob er heute ein Junge, ein Mädchen oder ein Helikopter ist, ist für uns die Genderideologie inakzeptabel und die Ehe die alleinige Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau.“
Queerfeindlichkeit, wie man sie aus Russland kennt. Fico kündigte zudem mehrfach an, dass er dafür sorgen werde, dass zukünftig von internationalen Stiftungen finanzierte NGOs als „ausländische Agenten“ gebrandmarkt werden, um deren vermeintliche „Herrschaft” über die Slowakei zu beenden – ein Gesetzesvorhaben sowohl nach ungarischem als auch nach russischem Vorbild. Dieses steht zum jetzigen Zeitpunkt noch aus, seine Umsetzung dürfte wohl nur eine Frage der Zeit bleiben. In anderen Bereichen hingegen treibt Fico den Demokratieabbau zügig voran.
Desinformation aus dem Kulturministerium
Fico hat ein Kabinett zusammengestellt, das seine Ideologie teilt und in jeder Hinsicht loyal ist, Kompetenz ist nebensächlich. Zu Hilfe kommt ihm, dass seit Mitte Juni 2024 Peter Pellegrini, Gründer der ebenfalls populistischen und mitregierenden Hlas-Partei, das Amt des Staatspräsidenten bekleidet, das nun anders als unter der Pellegrinis Vorgängerin, der liberalem Präsidentin Zuzana Čaputová, als Kontrollinstanz ausgefallen ist.
Kurz nach ihrem Amtsantritt sagte die Ministerin die einprägsame wie tautologische Phrase, die Kultur des slowakischen Volkes solle eine „slowakische“ sein, „und keine andere“, und propagiert seitdem slawische Kitsch-Folklore.
Unter den Kabinettsangehörigen gehört die Kulturministerin Martina Šimkovičová zu den umtriebigsten. Sie wurde von der rechten Slowakischen Nationalpartei SNS für das Amt nominiert, ist aber kein Parteimitglied. Die ehemalige Moderatorin des größten privaten Fernsehsenders der Slowakei, „TV Markíza“, ist ein bekanntes Gesicht der slowakischen Desinformationsszene: Sie gründete und moderierte noch lange Zeit nach Amtsantritt zusammen mit einem anderen SNS-Abgeordneten den Internet-Desinformationssender TV Slovan („TV Slawe“), den sie teilweise als offizielles Sprachrohr des Kulturministeriums nutzte und der wie eine preiswert produzierte Variante der Tucker-Carlson-Show wirkt.
Die Inhalte gleichen sich in der Tat stark, Migranten, Progressive und die queere Community sind die größten Feindbilder. Kurz nach ihrem Amtsantritt sagte die Ministerin die einprägsame wie tautologische Phrase, die Kultur des slowakischen Volkes solle eine „slowakische“ sein, „und keine andere“, und propagiert seitdem slawische Kitsch-Folklore. Im Januar erklärte sie in den sozialen Medien, LGBTQ-Organisationen könnten nicht länger vom „Geld des Kulturministeriums parasitieren“. Im Sommer dann behauptete sie gar, wegen LGBTQ-Personen sterbe die „weiße Rasse“ aus.
Anne Applebaum macht vor allem Verschwörungstheorien und Lügen, die sich ohne Filter durch etablierte Medien im Internet verbreiten und algorithmisch amplifizieren, als zentrales Instrument autoritärer Politiker aus. Es ist das gekonnte Spiel auf der Klaviatur nostalgischer Gefühle, das auf eine patriotische Sehnsucht nach vermeintlich harmonischer nationaler Einheit in der Vergangenheit bedienen und oft erst wecken will. Diese Aspekte verkörpert Šimkovičová auf fast schon karikatureske Weise.
Deportationsfantasien
Ficos Taktik für die Parlamentswahlen im Herbst des Jahres 2023 ging mit einer Verschärfung seiner bisherigen politischen Linie einher, und mit offenem Rassismus: Im Wahlkampf sagte er etwa, wenn es nicht anders gehe, werde man die illegale Einwanderung „auch mit Gewalt“ eindämmen. Paradoxerweise gibt es in der Slowakei aber ebenso wie in Ungarn kaum Migranten, sie durchqueren diese Länder nur auf dem Weg nach Deutschland oder in andere europäische Länder. Migranten und Minderheiten als Sündenböcke, dieses Motiv findet sich in Trumps Abschiebefantasien ebenso wie in der zunehmenden Verfolgung zentralasiatischer Migranten in Russland.
Prorussisch und Antiprogressiv
Es überrascht kaum, dass auch eine vehement prorussische Rhetorik zu Ficos Repertoire gehört. Er behauptete immer wieder, nicht Russland, sondern „ukrainische Nazis“ hätten den Krieg begonnen. Im Wahlkampf sagte er, die Ukraine werde mit ihm als Regierungschef „keine einzige Patrone mehr” von der Slowakei erhalten. Die größten Feindbilder neben Migranten und der Ukraine sind laut seinen Aussagen progressive NGOs, Politiker und Medien, die in der Slowakei im Hintergrund die Fäden ziehen und das Land vernichten würden. Applebaum argumentiert mit Karen Stenners Untersuchungen zur »autoritären Neigung«, viele Menschen fühlten sich zu autoritärem Denken hingezogen, weil sie keine Lust haben, sich auf Komplexität einzulassen. „Sie mögen keine Diskussionen, sie wünschen sich Einigkeit“, schreibt sie. „Bei einer plötzlichen Konfrontation mit Vielfalt, sei es von Meinungen oder Erfahrungen, verlieren sie die Fassung. Sie suchen Lösungen in einer neuen politischen Sprache, die mehr Gewissheit und Sicherheit verspricht.“
Hate-Speech und Spaltung
Diese Sprache beherrschen Fico und seine Mitstreiter hervorragend, und sie ist geprägt von Hate Speech. Wer nicht zum Lager der Regierungsunterstützer gehört, hat Grund sich zu fürchten. Dass die Rhetorik der Regierung aber in einem Attentat auf Fico selbst kulminieren würde, war eine gewaltige Überraschung sowohl für Regierungsbefürworter als auch -kritiker. Der 15. Mai wurde zum Schockmoment für eine gespaltene Nation.
Diese Spaltung jedoch hatte Fico mit seinem Team mitkonstruiert, sie gehört zu seinem Kalkül: der Graben zwischen „wir“ und „ihnen“, zwischen konservativer Dorf- und progressiver Stadtbevölkerung, zwischen dem wirtschaftlich besser gestellten Westen und dem ärmeren Osten, zwischen Befürwortern der pluralistischen Demokratie und jenen, die sich eine starke Führung wünschen – beide Seiten werden gegeneinander ausgespielt. Schon die Corona-Pandemie und der mit ihr einhergehende Frust bot für Fico einen optimalen Nährboden für sein Comeback.
Lücken im Justizsystem: Ein Einfallstor für Autokraten
Fico bekleidete das Amt des Premierministers nämlich bereits von 2006 bis 2010 und von 2012 bis 2018, abtreten musste er infolge von Massenprotesten nach dem Auftragsmord am Investigativjournalisten Ján Kuciak, bei dem auch dessen Verlobte ums Leben kam. Der junge Journalist hatte zu Verbindungen von Ficos Umfeld zur italienischen Mafia recherchiert. Dass Fico aber Abgeordneter des Parlaments blieb und das Justizsystem Lücken aufweist, gewährte ihm Schutz vor Strafverfolgung – obwohl er mutmaßlich zusammen mit seinem damaligen Innen- und jetzigen Verteidigungsminister Robert Kaliňák eine kriminelle Vereinigung gegründet hatte, wie die Sonderstaatsanwaltschaft (NAKA) befand. Sie sollen ihre politischen Machtpositionen ausgenutzt, politische Gegner unrechtmäßig verfolgt und sich an Unternehmen bereichert haben.
Und so ging Ficos Regierung als erstes die Justiz an. Noch im Winter 2023/24 versuchte sie im Schnellverfahren, Änderungen im Strafgesetz durchzusetzen. Die Justizreform, die das Parlament am 8. Februar billigte, sah vor, Strafen und Verjährungsfristen für schwere Verbrechen wie Mord, Vergewaltigung und Korruption zu verkürzen, die NAKA abzuschaffen, die in erster Linie in Korruptionsfällen ermittelt, und den Schutz von Whistleblowern zu schwächen.
Damit wollte Fico offensichtlich sich und seine wirtschaftlichen und politischen Verbündeten schützen. Zehntausende Slowakinnen und Slowaken protestierten gegen Ficos „Reformpläne“, und die EU-Kommission drohte im Falle einer Verabschiedung dieses Gesetzes mit der Aussetzung von Zahlungen. Dieser Druck von innen und von außen verhinderte die vollständige Umsetzung der Pläne, doch Teile wie die Auflösung der NAKA wurden in den vergangenen Monaten tatsächlich implementiert. Dass das möglich war, dazu hat auch die Verunsicherung nach dem Attentat beigetragen.
The survivor takes it all
Knapp einen Monat nach dem Mordversuch auf Fico folgte ein Attentat auf den damaligen Kandidaten zum US-Präsidenten Donald Trump. Beide Attentäter vereint, dass sie keine eindeutige politische Agenda verfolgten und synkretistische Weltanschauungen hatten. Auch die Folgen weisen Gemeinsamkeiten auf: Sowohl Fico als auch Trump konnten sich, nachdem sie überlebten, als (verhinderte) Märtyrer für ihre politischen Ideale inszenieren.
Behörden können nun etwa Versammlungen verbieten, wenn sie “die öffentliche Ordnung gefährden“. Was genau das bedeutet, ist nicht genauer definiert.
Fico behauptete noch aus seinem Krankenzimmer heraus, der Attentäter sei ein „Agent der Opposition“ gewesen und warnte die „regierungsfeindlichen Medien, insbesondere diejenigen, die im Besitz der Finanzstruktur von George Soros sind“ davor, etwas anderes zu behaupten. Fico bot das Attentat einen willkommenen Vorwand, weitere Maßnahmen gegen Protest an seinem politischen Kurs durchzusetzen.
So trat Mitte Juli 2024 das sogenannte Lex Attentat in Kraft, das die Einschränkung der Versammlungsfreiheit – vorgeblich der nationalen Sicherheit zu Liebe – erleichtert. Behörden können nun etwa Versammlungen verbieten, wenn sie „die öffentliche Ordnung gefährden“. Was genau das bedeutet, ist nicht genauer definiert. Die Zeit nach dem Anschlag war zudem ein idealer Moment, um die Axt an den öffentlichen Rundfunk anzulegen, der Ficos Vorgehen kritisch kommentierte. Die Idee, die öffentlichen Medien in der Slowakei in Staatsmedien umzuwandeln, stammt ursprünglich von Kulturministerin Šimkovičová und wurde am 1. Juli in die Tat umgesetzt. Die Proteste dagegen waren wegen des Attentats bescheiden.
Bromances unter Autokraten
Nach ihren jeweiligen Attentaten demonstrierten Fico und Trump einander persönliche Nähe. Über ein gemeinsames Telefonat mit Trump Ende November schrieb Fico auf Facebook: „Wir waren mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert, nämlich mit Versuchen, uns ins Gefängnis zu stecken und uns physisch zu eliminieren, was unseren Gegnern glücklicherweise nicht gelungen ist.“
In einem zweiten Beitrag am selben Tag teilte Fico ein Foto mit Putin und schrieb, er wolle am 9. Mai 2025 an den „Feierlichkeiten zum Sieg über den Faschismus“ in Moskau teilnehmen; wenig überraschend, war er doch schon Ende Oktober im russischen Staatsfernsehen aufgetreten, wo er einen solchen Besuch bereits angesprochen hatte.
Doch bis Mai wartete er nicht, sondern besuchte Putin am 22. Dezember 2024 unangekündigt im Kreml. Im Fokus des Gesprächs standen die russischen Gaslieferungen, die die Slowakei zu diesem Zeitpunkt nach wie vor über die Ukraine bezog – der Transit von russischem Gas wurde aber zum 1. Januar eingestellt, nachdem der alte Vertrag über Gastransit ausgelaufen war. Fico bot Putin bei dieser Gelegenheit auch Friedensverhandlungen auf slowakischem Boden an – eine Idee, die Putin gefiel, vielen slowakischen Bürgerinnen und Bürgern hingegen missfiel und sie zu lauten Protesten animierte.
Kulturelle Revolution und zivilgesellschaftlicher Widerstand
Je mehr kulturelle Institutionen Šimkovičovás Kahlschlag zum Opfer fallen, desto präsenter wird der Widerstand auf der Straße. Die Ministerin schloss die Kunsthalle Bratislava, feuerte die beliebten Leiterinnen und Leiter von Nationaltheater, -galerie, -bibliothek und diversen weiteren Einrichtungen und ersetzte sie durch Bekannte ohne jegliche Erfahrung im Kulturbereich. Sie normalisierte die Zusammenarbeit mit russischen und belarusischen Einrichtungen und ist verantwortlich für umstrittene Neuerungen, die seit 1. August die Verteilung von Geldern aus öffentlichen Kulturfonds regeln. Künftig droht zahlreichen Kulturprojekten im ganzen Land deshalb ein Förderstopp.
Am 17. Januar 2024 schon wurde im Internet ein Aufruf geteilt, der den Rücktritt der Ministerin forderte und mehr als 188.494 Unterschriften erhielt – mehr als jede andere Onlinepetition in der Geschichte der Slowakei. Der Aufruf scheiterte, das Ministerium erkannte die Unterschriften nicht an. Anschließend bildete sich jedoch das wohl größte und lautstärkste Bündnis zum Schutz der Kultur aus, die Initiative „Otvorená Kultúra!“ (Offene Kultur!). Sie ruft seitdem regelmäßig zu Protesten gegen die Kulturpolitik und Ficos Regierung auf und verkündete im September einen „Kulturstreik“, einen Warnstreik von Kulturarbeiterinnen und -arbeitern im ganzen Land.
Rückabwicklung der »autokratischen Blaupause«
Mit dem Vorgehen der slowakischen Regierung in der Form systematischer Aushöhlung des Rechtsstaats, der Schwächung der Justiz, der „Feindmarkierung“ innerhalb bestimmter gesellschaftlicher Gruppen findet in der Slowakei eine autokratische Blaupause Anwendung, die der Strategie anderer Länder wie Ungarn stark ähnelt – und die auch vor der zweiten Inauguration von Donald Trump diskutiert wird. Die detaillierten Pläne des konservativen Thinktanks „Heritage Foundation“ unter dem Namen „Project 2025“ für den Umbau des Staates unter einer zweiten Regierung von Donald Trump geben allen Anlass dazu.
Die autokratischen Staatsstreiche setzen in den Sphären Justiz, Medien, staatliche Institutionen und Kultur an, wie Applebaum ausgemacht hat. Es sind exakt die Bereiche, die Fico und seine Mitstreiter seit etwas über einem Jahr in der Slowakei radikal umkrempeln. Und es ist davon auszugehen, dass sie ihren Kurs weiter fortsetzen. Doch ihr Vorgehen sorgt für lauten Widerspruch in der Zivilgesellschaft. Er erinnert daran, dass der Autoritarismus nicht in Stein gemeißelt ist, und das Beispiel Polen zeigt, dass der Weg zurück möglich ist – wenn auch unter großen Anstrengungen.